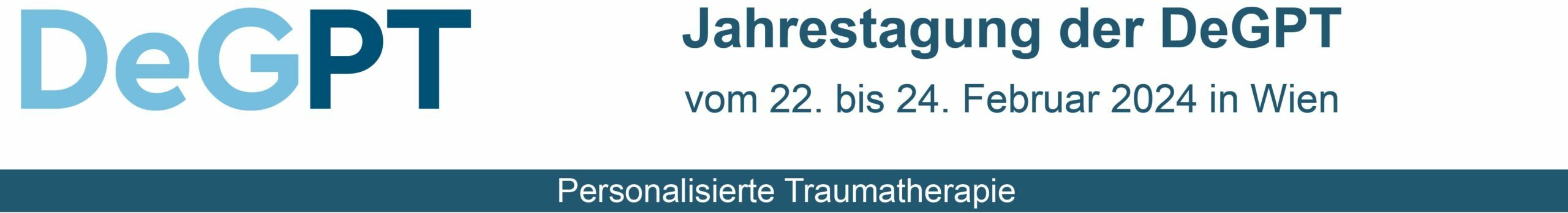Programm 2024
Programmheft 2024 zum download.
Abstractband „Trauma und Gewalt“ 2024 zum download.
Donnerstag 22 Feb 2024
9:00 - 12:30 Preconference-Workshop
Positive Beziehungserfahrungen durch bindungsfokussierte Fallreflexionen
Christina Kohli, Elsbeth Ball, Carmelo CampanelloSR 3, Hof 7
Unter dem Dach der sozialpädagogischen Krisenwohngruppe (KWG) Winterthur werden Kinder und Jugendliche von 4-16 Jahren, die sich in einer schweren Krise befinden, aufgenommen. Aufgrund von andauernden, meist traumatisierenden Lebensbedingungen sind sie hoch belastet und zeigen teilweise, irritierende bis zerstörerische Verhaltensweisen. Sie zu verstehen ist oft nicht einfach, es besteht die Gefahr, durch ihre Verhaltensweisen fehlgeleitet zu werden.
Positive Beziehungserfahrungen können initiiert werden, wenn ein Verständnis für die Verhaltensweisen der Kinder und Jugendlichen entwickelt und beziehungsfördernde Interaktionen geschaffen werden. Dazu haben wir ein standardisiertes Instrument entwickelt. Dieses kommt in den wöchentlich stattfindenden interdisziplinären bindungsfokussierten Fallsupervisionen zum Einsatz.
In diesem Workshop sollen Einblicke in die interdisziplinäre, traumasensible und bindungsfokussierte Arbeit gewährt und Hilfreiches, Erprobtes weitervermittelt werden.
Verfolgung, Folter und Flucht – psychische Folgen von Menschenrechtsverletzungen in der Psychotherapie
Barbara PreitlerHS B, Hof 2
Die psychotherapeutische Arbeit mit geflüchteten Personen in Mitteleuropa wird immer wieder von politischen und sozialen Faktoren mitgeprägt – wenn auch der Kern der Arbeit gleich bleibt: durch Menschenrechtsverletzungen extrem traumatisierte Menschen brauchen sichere therapeutische Beziehungen, in denen sie mit ihrem Leiden aber auch mit ihrer Resilienz anerkannt werden.
Wie diese Beziehungen im Rahmen der aktuellen Gesetzgebung und der medialen Aufmerksamkeit gelingen können und mit welchen Problemen wir uns konfrontiert sehen, ist Inhalt dieses Workshops.
Begutachtung psychisch reaktiver Traumafolgen im Sozialen Entschädigungsrecht und der gesetzlichen Unfallversicherung, Gutachtenstandards der DeGPT
Ferdinand Haenel, Doris DenisSR 1, Hof 1
Häufig ist festzustellen, dass klinische Gutachter:innen in der Kausalitätsbeurteilung psychisch reaktiver Traumafolgen oft zu extrem gegensätzlichen Ergebnissen gelangen. Neben symptombedingter Behinderung der Exploration und besonderen Beziehungsaspekten, die die Objektivität der gutachterlichen Beurteilung beeinträchtigen können, sind es eine Vielzahl möglicher komorbider Störungen, die psychisch reaktive Traumafolgen überlagern und so zu Fehlbeurteilungen bei der Begutachtung führen können. Eine schädigungsunabhängige psychische Vorerkrankung macht die Beurteilung vollends schwierig.
Aus diesem Grund hat die DeGPT ein zertifiziertes Fortbildungscurriculum verabschiedet, welches psychologische und ärztliche Fachkolleg:innen in die Lage versetzen soll, klinische Gutachten zu psychisch reaktiven Traumafolgen und ihrer Genese in sozialrechtlichen Verfahren fachkompetent zu erstellen. Die von der DeGPT entwickelten Standards für die schriftliche Gutachtenerstellung sollen dabei eine ausreichend begründete und für Dritte nachvollziehbare Beurteilung garantieren, die in der Praxis nicht immer gegeben ist.
In diesem Workshop sollen die speziellen Probleme anhand von Fallbeispielen (gerne auch mitgebrachte Fälle von Teilnehmer:innen) illustriert, die Standards der DeGPT zur Gutachtenerstellung der DeGPT erläutert und auf Besonderheiten bei der gutachterlichen Exploration und Beurteilung hingewiesen werden.
http://www.degpt.de/curricula/degpt-curriculum-begutachtung.html
Literatur:
Haenel F, Denis D, Freyberger H. Die Begutachtung psychisch reaktiver Traumafolgen im Rahmen des OEG. In: Seidler GH, Freyberger HJ, Maercker A. Handbuch der Psychotraumatologie. Stuttgart 2019; S.1008-1018
Denis D, Haenel F.(Hrsg) „Begutachtung psychisch reaktiver Traumafolgen im SER; GUV und Aufenthaltsrecht“, Trauma & Gewalt - Themenheft 15.Jg., Heft 2, Mai 2021
Konzentrative Bewegungstherapie (KBT) – Ein strukturierender, körper- und handlungsorientierter Ansatz zur Überwindung von Traumafolgen
Silvia MayerAula, Hof 1
In der Traumatherapie kommen wir um den Körper „nicht herum“, was sich am aktuellen Forschungsdiskurs und an Tagungstiteln abbildet.
Nach Sylvia Cserny ist „der Körper der Ort des psychischen Geschehens“. Trauma findet immer auch am und im Körper statt. Erst durch die Zuwendung zum Körper und zur Seele können Traumatisierungen verarbeitet und integriert werden. Die KBT eignet sich dafür in besonderer Weise.
In Österreich ist die Konzentrative Bewegungstherapie als Psychotherapie anerkannt. Sie verbindet ihre eigenständige Theorie als Bewegungs-Psychotherapie mit tiefenpsychologischen/psychodynamischen, kognitiven und entwicklungspsychologischen Konzepten. Darüber hinaus dienen psychosomatische Erklärungsmodelle sowie Erkenntnisse der Neurowissenschaften der Theoriebildung.
Durch ihre strukturierte und strukturierende Herangehensweise („Vom Ich zum Du zum Wir“; „Vom Sitzen zum Stehen zum Gehen“, …), sowohl im Einzel- als auch im Gruppensetting, ermöglicht sie, Grundlegendes (immer wieder neu) für sich zu erfahren.
Körper- und handlungsbezogene Angebote laden dazu ein, eigene Muster und das „So-Geworden-Sein“ zu erfassen und zu verstehen, sowie korrigierende und adaptive Möglichkeiten für sich und mit anderen zu erforschen. Elsa Gindler spricht von „Erfahrbereit sein“ und vom „Lauschen, wo die Bewegung hinwill“.
Die KBT ermöglicht insbesonders auch traumatisierten Menschen die Förderung der Regulationsfähigkeit im geschützten Raum; sie bietet auf vielfältige Weise die Möglichkeit, der Selbst- und Objektwahrnehmung, sowie den Themen Bindung, Kontrolle/Sicherheit, Selbstwirksamkeit und Selbstwert, Schutz, Raum, Kraft und Aufrichtung, … nachzuspüren und sich durch konkretes Handeln zunehmend (wieder) handlungsfähig(er), selbstwirksam(er) und selbstbestimmt(er) zu erleben.
In diesem Workshop wollen wir anhand einiger praktischer Angebote in den Wahrnehmungs- und Erfahrungsraum eintauchen, den die KBT mit ihrem körper- und handlungsorientierten Ansatz Betroffenen bieten kann. Besondere Herausforderungen, die sich aus der Arbeit mit dieser PatientInnengruppe ergeben, werden thematisiert und diskutiert.
Verlust, Tod und Trauer bei Kindern und Jugendlichen – Reaktionen und Hilfestellungen
Gertrude BogyiHS C2, Hof 2
Der Themenbereich „Verlust, Tod und Trauer“ bei Kindern und Jugendlichen ist nach wie vor ein großes Tabu. Trauer wird zumeist mit Tod und Sterben in Verbindung gebracht. Es wird wenig beachtet, dass es viele Veränderungen, Trennungen und Verluste gibt, wie etwa Übersiedlung, Schuleintritt, Krankenhausaufenthalte, Scheidung der Eltern, Jobverlust eines Elternteils und ähnliches mehr, die ebenso Trauerarbeit notwendig machen. Jorgos Canacakis definiert: „Trauer ist die gesunde, lebensnotwendige, kreative Reaktion auf Verlust- und Trennungsereignisse.“
Kinder werden gerne vertröstet, Tatsachen werden beschönigt und beschwichtigt. Jugendlichen spricht man oft Trauer ab, da sie sich im Verhalten anders als erwartet zeigen. Kinder trauern anders als Erwachsene oder Jugendliche. Drei Leitsätze sind wesentlich: „es ist, was es ist“ (Erich Fried), „die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar“ (Ingeborg Bachmann) und „das Totschweigen des Todes ist ein Problem der Erwachsenen und nicht der Kinder“ (Gertrude Bogyi).
Im Folgenden sollen Reaktionen von Kindern und Jugendlichen beschrieben werden, die nicht selten zu Missverständnissen führen. Immer wieder verdrängen Kinder zunächst ein Geschehen und tun so, als ob nichts wäre. Dies verführt die Erwachsenen leider dazu „mitzuspielen“ und dem Kind die Wahrheit zu verschweigen. Das Kind hat den verständlichen Wunsch, dass alles „normal“ weitergeht und verleugnet deshalb etwa die Tatsache des Todes, der Scheidung, der Krankheit. Manchmal zeigen sich Kinder auch übertrieben heiter, was bei Erwachsenen nicht selten zur Annahme führt, dass sie nicht trauern. Wut und Aggression gehören zu jedem Trauerprozess, werden aber oft nicht zugelassen und als unpassend empfunden und der Zusammenhang wird nicht erkannt. Schuldgefühle spielen ebenso eine große Rolle, wie die Angst, weiteres zu verlieren. Kinder weinen oft dann nicht, wenn es erwartet wird, sind aber bei kleinen Anlässen weinerlich und besonders empfindlich. Kinder trauern sprunghaft, punktuell.
Wichtig ist es, die Wahrheit zu sagen, sie am Geschehen, an den Ritualen, teilnehmen zu lassen, versuchen, sie in ihren Gefühlen zu verstehen, sich aber nicht aufdrängen. Vor allem ist es wichtig, eigene Gefühle anzusprechen. Jugendlichen fällt es meist schwer, ihre Gefühle zu verbalisieren. Sie kapseln sich oft ab, suchen verstärkt Ablenkung, das Autonomiebestreben verstärkt sich. Durch ihr Verhalten erfahren sie oft Ablehnung, finden kein Verständnis. Bei jedem Verlust sind Alter und Entwicklungsstufe, Persönlichkeitsstruktur des Kindes, Rolle der verlorenen Person im Gesamtleben, Art der Beziehung vor der Trennung oder dem Verlust und Reaktion bzw. Hilfestellung durch das Umfeld von Bedeutung. Obwohl Trauerwege sehr individuell sind, lassen sich doch einige gemeinsame Aspekte beschreiben.
Reaktionen und Interventionen sollen in diesem Workshop anhand von Fallbeispielen besprochen werden.
10:00 - 17:00 Paper in a day - Workshop
Informationen über den Workshop folgen in Kürze
Paper in a day – Workshop der Zeitschrift Trauma und Gewalt für Nachwuchswissenschaftler:innen
Heide Glaesmer, Ingo SchäferSR 2, Hof 1
22.02.2024, 10-17 Uhr – kostenfreier Workshop
In frühen Phasen ihrer wissenschaftlichen Karriere ist es für angehende Forscher:innen besonders wichtig, Routine im Schreiben von wissenschaftlichen Artikeln zu entwickeln. Auch das Knüpfen von Kontakten und der Austausch mit Kolleg:innen spielt eine wichtige Rolle. In diesem von der Zeitschrift „Trauma und Gewalt“ ausgerichteten Workshop haben Nachwuchswissenschaftler:innen die Gelegenheit an einem konkreten Manuskript mitzuwirken, das später in „Trauma und Gewalt“ publiziert werden soll, sowie Kontakte zu knüpfen und zu erweitern und eine Basis für weitere Kooperationen zu legen. Im Workshop soll unter Betreuung der beiden Leiter*innen ein Manuskript vorbereitet und geschrieben werden. Der Schreibprozess wird über den Workshop hinaus begleitet. Zielgruppe sind Kolleg:innen, die sich in frühen Phasen ihrer Karriere befinden (z.B. Masterand:innen und Doktorand:innen). Von den Teilnehmenden wird Folgendes erwartet:
- Teilnahme am Vorbereitungstreffen (online) am 08.02.2024.
- Vollständige Anwesenheit am Workshop
- Teilnahme an zwei Videokonferenzen in den folgenden Monaten
- Erledigung von spezifischen Aufgaben nach jeder der drei Konferenzen
- Beteiligung an der Finalisierung des entstehenden Manuskripts.
13:30 - 17:00 Preconference-Workshop
Individuelle Behandlungsplanung bei Patient:innen mit komplexen Traumafolgestörungen
Martin SackHS C2, Hof 2
Erfahrungen von schwerer Gewalt und Vernachlässigung vor allem in der Kindheit und Jugend können im späteren Leben zu einer Vielzahl von psychischen und psychosomatischen Symptomen führen. Typische Folgen sind Probleme mit der Regulation von Affekten, der Selbstakzeptanz, Scham, Schuldgefühle und Probleme in zwischenmenschlichen Beziehungen. Der Zusammenhang zwischen kindlichen Traumatisierungen und körperlichen wie psychischen Erkrankungen ist auch durch aktuelle Befunde der Neurobiologie eindrücklich belegt. Die Diagnose komplexe PTBS findet zunehmend Anerkennung und wird voraussichtlich in die ICD-11 eingeführt werden.
Zentrale Elemente der Behandlung sind therapeutischer Beziehungsaufbau, Förderung der Affektregulation, Verbesserung von Selbstbezug und Selbstwert sowie Förderung der Beziehungsfähigkeit. Auf die Indikation zum Einsatz traumakonfrontativer Methoden bei Patienten mit komplexen Traumafolgestörungen und wird im Rahmen einer methodenintegrativen und auf individuelle Behandlungsbedürfnisse ausgerichteten Behandlungsplanung besonders eingegangen. Es ist erwünscht, dass Teilnehmer eigene Fallbeispiele und Fragen aus der Praxis einbringen.
Existentielle Psychotraumatherapie – Kernfragen des Daseins in der therapeutischen Praxis. Ein neuer Ansatz zur Behandlung belastender Selbst- und Weltkonzepte.
Helmut RießbeckSR 1, Hof 1
Solange Menschen keine größeren Lebensbelastungen haben, können sie Themen wie Tod, Einsamkeit, Verantwortung oder Sinnlosigkeit häufig ignorieren. Schicksalsschläge oder Traumatisierungen lösen für viele, Erfahrungen aus Krieg und Pandemie wohl für die meisten, diese sicher geglaubte Distanz auf. Das innere Gleichgewicht wird anhaltend erschüttert. Klinisch finden sich inzwischen häufig Überlappungen zwischen individuellen traumareaktiven Mustern und Beschwerden, die sich aus der Konfrontation mit den gegenwärtigen Weltkrisen ergeben.
Die existentielle Psychotherapie sieht einen Grundkonflikt als zentral im Erleben und Handeln von Menschen, den der Konfrontation mit den Gegebenheiten der Existenz. Irving D. Yalom und andere haben schon vor mehr als 40 Jahren hilfreiche Konzepte entwickelt, um Menschen durch existentielle Herausforderungen zu begleiten. Diese erwiesen sich für Menschen in traumatischem Stress als nur wenig geeignet. Für den Traumakontext hat der Referent daher die existentielle Psychotherapie für traumatische Erschütterungen neu formuliert.
Aus klinischer Perspektive werden die zentralen Grunddimensionen vorgestellt:
• Verlust von Integrität, Verletzlichkeit, Endlichkeit und Tod
• Wille und Freiheit, Verantwortung
• Isolation und Einsamkeit, Bindungserschütterung
• Auseinandersetzung mit dem „real Bösen“
• Lebenssinn, Entfaltung der Potenziale und Verzicht
Ziel der Interventionen ist die Umarbeitung negativer Selbst- und Weltkonzepte
Anhand zweier Langzeittherapien komplexer Traumafolgestörung werden die Schritte
• Markieren der Grunddimension und Expressionsfähigkeit
• Symptomebene, konstruktive Nutzung der Abwehr
• Spez. Beziehungsarbeit
• Interventionstechniken, Nutzung von Alltagsphänomenen
gezeigt und der klinische Verlauf vorgestellt.
(Veröffentlichung hierzu: Rießbeck, H., Existentielle Perspektiven in der Psychotraumatologie, Nov. 2021, Klett-Cotta Verlag)
Wenn das Trauma mit am Küchentisch sitzt
Jochen Binder, Christina KohliAula, Hof 1
Wenn Kinder oder Erwachsene traumatisiert wurden, hat dies nicht nur auf das Leben des Einzelnen massive Auswirkungen, sondern das Familiensystem als Ganzes steht oft vor grossen Herausforderungen und Belastungen. Auch nicht traumatisierte Familienmitglieder leiden oft unter den Symptomen und Folgen. Teilweise begegnen wir Familien, in denen Kinder und Eltern traumatisiert sind. Im Praxisalltag erleben wir leider zu oft, dass in den Einzeltherapien die systemische Ebene zu wenig gesehen wird. Durch die Trennung von Kinder-/Jugendtherapie und Erwachsenentherapie ergeben sich Hindernisse in der Zusammenarbeit. Uns stehen heute gut fundierte und wirksame Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die jedoch zu selten eine Verknüpfung vom Einzelnen zur Familie herstellen.
Wir wollen im Workshop diese Lücke schliessen und den Teilnehmenden die Möglichkeit geben, den Blick auf das ganze Familiensystem und dessen Behandlungsmöglichkeiten zu richten. Dabei werden wirksame Therapieoptionen, Interventionsmöglichkeiten und wichtige Zusammenhänge, die im Therapiealltag gut umsetzbar sind, vorgestellt.
Die traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie (Tf-KVT)
Thorsten SukaleHS B, Hof 2
Die traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie (Tf-KVT) ist ein evidenzbasiertes Verfahren zur Behandlung einfacher und komplexer posttraumatischer Belastungsstörungen im Kindes- und Jugendalter. Der Behandlungsansatz beruht auf den Arbeiten von Judith A. Cohen, Esther Deblinger und Anthony P. Mannarino, die in den USA psychotherapeutische Programme zur Überwindung von Folgen traumatischer Ereignisse wie sexuellem Missbrauch, Verlust eines geliebten Menschen, Erfahrungen von Gewalt, Terror u. a. Katastrophen entwickelten und publizierten. Die Tf-KVT integriert Elemente der klassischen KVT und adaptiert diese auf Traumafolgestörungen bei 4- bis 18-jährigen Kindern und Jugendlichen.
Im Rahmen des Workshops werden die verschiedenen Komponenten der Tf-KVT (Psychoedukation, Entspannungsverfahren, Emotionsregulation, Veränderung dysfunktionaler Kognitionen, Arbeit mit Traumanarrativen, Einübung von Copingstrategien, Arbeit mit den Eltern usw.) in theoretischer und praktischer Hinsicht vermittelt. Der Fokus im Workshop soll auf der Traumaexposition mit Hilfe des Traumanarratives liegen.
Behandlung der Komplexen PTBS: Das Therapieprogramm „STAIR/NT“
Ingo Schäfer, Janine BorowskiSR 3, Hof 7
Personen, die in ihrer Kindheit sexuellen Missbrauch oder Misshandlung erlebt haben, leiden oft nicht nur unter Symptomen der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), sondern auch unter weiteren Beeinträchtigungen, etwa einer eingeschränkten Affektregulation, Schwierigkeiten in interpersonellen Beziehungen und einem negativen Selbstbild. Gerade diese zusätzlichen Symptombereiche, die inzwischen als typische Beschwerden im Rahmen einer „Komplexen PTBS“ interpretiert werden, tragen maßgeblich zu den Alltagseinschränkungen Betroffener bei. Bei „STAIR/Narrative Therapie“ handelt es sich um einen Behandlungsansatz, der genau diese Bereiche systematisch berücksichtigt und zusätzlich zur Reduktion der PTBS-Symptomatik eine flexible Behandlung von Defiziten der Emotionsregulation und der interpersonellen Kompetenzen bei traumatisierten Personen erlaubt. Das Therapieprogramm integriert in einem phasenorientierten Vorgehen wirksame Interventionen zur Behandlung komplexer Traumafolgestörungen und wird in den neuen Behandlungsleitlinien als eines der Standardverfahren empfohlen. Im Workshop wird ein Überblick über das Therapieprogramm gegeben sowie auf seinen Einsatz im Einzel- wie im Gruppensetting eingegangen. Neben der theoretischen Einführung wird es eine Reihe von praktischen Übungen geben.
Literatur
Cloitre M, Cohen LR, Koenen KC (2013) Sexueller Missbrauch und Misshandlung in der Kindheit. Ein Therapieprogramm zur Behandlung komplexer Traumafolgen. Göttingen: Hogrefe-Verlag.
18:00 - 19:30 Tagungseröffnung, Öffentlicher Vortrag
Informationen über die Tagungseröffnung folgen in Kürze
Öffentlicher Abendvortrag
Michael MusalekHS C1, Hof 2, Hörsaalzentrum
Amor vitae als Antwort in Krisenzeiten
Wir leben in Krisenzeiten: Corona-Pandemie, Ukrainekrieg, Naturkatastrophen, Finanzkrise, Demokratiekrise, Regierungskrisen, Gesellschaftskrisen, Beziehungskrisen - Krisen überall! Damit stellt sich die Frage, wie kann man diese Krisen bewältigen? Welche Auswege kann man finden? Und wenn wir uns mit den Auswegen aus Krisen beschäftigen, müssen wir uns vor allem auch fragen, wohin sollen diese Auswege führen, was ist das Ziel der Krisenbewältigung? Ist es die „Abschaffung“ bzw. „Auflösung“ der Krise, ist es ein „Abstand-gewinnen“ von der Krise oder müssen wir einfach nur lernen, mit der Krise zu leben, sie als eine Form des Schicksals zu akzeptieren oder darüber hinausreichend sie auch lieben zu lernen, wie es uns Friedrich Nietzsche mit seinem „Amor-fati-Konzept“ vorschlug? Oder sollten wir nicht vielmehr im Sinne eines „Amor-vitae-Konzepts“ die Krisen zum akzeptierten Ausgangs- und Angelpunkt eines im Vergleich zum Vorher attraktiveren und freudvolleren Lebens machen, um uns damit die Möglichkeit zu eröffnen, dieses unser Leben selbst lieben zu lernen.
Freitag 23 Feb 2024
9:00 - 10:30 Vorträge, Keynote Speaker
Individuelle Therapieplanung – wie lässt sich das konkret umsetzen?
Martin SackHS C1, Hof 2, Hörsaalzentrum
Psychotherapeutische Behandlungen werden heute bevorzugt an störungsspezifischen Behandlungskonzepten ausgerichtet. Hierbei wird oft nicht ausreichend berücksichtigt, dass die gleiche Symptomatik ganz unterschiedliche Ursachen haben kann und dass häufig über eine Reduktion der Symptomatik hinausgehende Behandlungsbedürfnisse vorliegen.
Entscheidend für die Klärung individueller Behandlungsziele im Sinne einer therapiebezogenen Diagnostik ist die Exploration des individuellen Leids der Patient:innen. Für die Therapieplanung sind darüber hinaus symptomorientierte Behandlungsziele, aber auch unbefriedigte Grundbedürfnisse sowie behandlungsrelevante biographische Stressoren zu berücksichtigen. Die Wahl der geeigneten Behandlungsmethode sollte den individuellen Zielen und der Persönlichkeit der Patient:innen flexibel angepasst werden. Eine Therapieschulen übergreifende Perspektive ermöglicht es, den individuellen Behandlungsbedürfnissen gerecht zu werden. Diese Vorgehensweise erweist sich in der Behandlung von Patient:innen mit komplexen Traumafolgestörungen als besonders günstig.
Skalierbare, automatisierte und praktikable Risikostratifizierung der posttraumatischen Belastungsreaktion und personalisierte Traumatherapi
Katharina SchultebraucksHS C1, Hof 2, Hörsaalzentrum
Der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens im Bereich der psychischen Gesundheit hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Trotz des raschen Fortschritts und der vielversprechenden Möglichkeiten hat die KI bisher nicht ihr volles Potenzial in der psychiatrischen Forschung und klinischen Versorgung entfaltet.
In diesem Vortrag werden konzeptionelle Grenzen, technische Herausforderungen, Erklärbarkeit und klinischer Nutzen erörtert. Dr. Schultebraucks wird Beispiele für digitale Ansätze in der Psychiatrie aus ihrer eigenen multidisziplinären Forschung vorstellen, die sich darauf konzentrieren, das Fachwissen von klinischen Praktikern mit den jüngsten Fortschritten des maschinellen Lernens und der digitalen Phänotypisierung zusammenzubringen. Sie wird erörtern, wie diese Ansätze ein hohes Potenzial für die klinische Anwendung haben und die Skalierbarkeit und Genauigkeit klinischer Beurteilungen verbessern können. Angesichts dieser jüngsten Fortschritte bei der Risikoprognose und personalisierten Therapieauswahl werden abschließend die klinischen Implikationen für die künftige Verwendung von Ansätzen des maschinellen Lernens zur Vorhersage und Überwachung von posttraumatischem Stress und Resilienz im klinischen Umfeld erörtert.
11:00 - 12:30 Symposien 1
Intergenerationale Weitergabe und intergenerationale Perspektiven von erlebter Gewalt – Biologische, psychosoziale und gesellschaftliche Zusammenhänge
Maria Böttche, Heide GlaesmerHS C1, Hof 2, Hörsaalzentrum
Meine Kindheit – Deine Kindheit? Intergenerationale Weitergabe von biologischen Veränderungen durch Missbrauchserfahrungen in der Kindheit von Frauen an ihre Kinder
Melissa Hitzler, Anja Gumpp, Alexandra Bach, Iris Tatjana Kolassa
An intergenerational perspective on conflict-related sexual violence (CRSV) against women: female survivors and their children born of rape born after WWII in Germany
Heide Glaesmer, Sophie Roupetz
Psychische Belastung und Antisemitismuserfahrungen bei Nachfahren der 2. und 3. Generation von Holocaust-Überlebenden in Israel, Deutschland und den USA
Freya Specht, Yuriy Nesterko, Nadine Stammel, Maria Böttche
Psychische Belastung während der COVID-19-Pandemie – Befunde zu Langzeitverläufen und vermittelnden Faktoren
Annett Lotzin, Brigitte Lueger-SchusterHS C2, Hof 2, Hörsaalzentrum
Von Resilienz bis Chronizität: Heterogene Verläufe von Depressions- und Angstsymptomen während der COVID-19-Pandemie in Deutschland
Laura Kenntemich, Leonie von Hülsen, Laura Eggert, Levente Kriston, Ingo Schäfer, Annett Lotzin
Wie hängt Kindheitsvernachlässigung mit depressiven Symptomen zusammen? Der mediierende Effekt von vermeidendem Copingverhalten
Laura Eggert, Laura Kenntemich, Leonie von Hülsen, Jürgen Gallinat, Ingo Schäfer, Annett Lotzin
Pandemiespezifische Stressoren, Risikofaktoren und klinische Symptome bei Frauen während der COVID-19-Pandemie – eine Netzwerkanalyse zu länderspezifischen Unterschieden
Leonie von Hülsen, Laura Kenntemich, Laura Eggert, Brigitte Lueger-Schuster, Dean Ajduković, Marina Ajduković, Margarida Figueiredo-Braga, Luisa Sales, Filip K. Arnberg, Kristina Bondjers, Jürgen Gallinat, Ingo Schäfer, Annett Lotzin
Anpassung und Wohlbefinden in späteren Phasen der COVID-19 Pandemie – ein Vergleich zwischen Österreich und Kroatien
Irina Zrnić Novaković, Alina Streicher, Dean Ajduković, Marina Ajduković, Jana Kiralj Lacković, Annett Lotzin, Brigitte Lueger-Schuster
„Long COVID”: Psychische Belastung, chronischer Stress und COVID-19-bezogener post-traumatischer Stress
Sofia-Maria Oehlke, Andreas Goreis, Diana Klinger, Paul L. Plener, Oswald D. Kothgassner
Komplexe posttraumatische Belastungsstörungen (kPTBS) – Psychopathologien und Psychotherapie
Astrid Lampe, Johannes KruseHS A, Hof 2
Epistemisches Vertrauen und Strukturniveau mediieren den Zusammenhang zwischen Erfahrungen von Missbrauch und Vernachlässigung und (komplexer) posttraumatischer Belastungsstörung im Erwachsenenalter
Hanna Kampling, Johannes Kruse, Astrid Lampe, Tobias Nolte, Nora Hettich, Elmar Brähler, Cedric Sachser, Jörg M. Fegert, Stephan Gingelmeier, Peter Fonagy, Lina Krakau, Sandra Zara, David Riedl
Charakterisierung von Borderline-Patient:innen mit und ohne PTBS-Symptomen: Unterschiede in epistemischer Haltung, Mentalisierungsfähigkeit, kindlichen Traumata und Symptombelastung
Tobias Nolte, Eileen Lashani, Martin Debbane, Eva Rüfenacht, Nader Perroud, Astrid Lampe, Johannes Kruse, David Riedl, Hanna Kampling, Anthony Bateman, Read Montague, Peter Fonagy
Psychopathologie und Psychotherapie-Inanspruchnahme von Menschen mit komplexer posttraumatischer Belastungsstörung (kPTBS) – Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung in Deutschland
David Riedl, Hanna Kampling, Johannes Kruse, Tobias Nolte, Elmar Brähler, Jörg M. Fegert, Cedric Sachser, Christina Kirchhoff, Vincent Grote, Michael J Fischer, Astrid Lampe
Patienten mit komplexer posttraumatischer Belastungsstörung (kPTBS) in der stationären Behandlung – Ergebnisse einer monozentrischen Pilotstudie
Astrid Lampe, David Riedl, Hanna Kampling, Tobias Nolte, Christina Kirchhoff, Vincent Grote, Michael J Fischer, Johannes Kruse
The impact of adverse childhood experiences on psychosocial and somatic conditions across lifespan
Christian Schmahl, Paul PlenerHS B, Hof 2
Early life adversities distinguish risk trajectories for internalizing and externalizing symptoms
Seda Sacu, Tobias Banaschewski, Nathalie Holz, Katharina Schultebraucks
The Augmentative Effect of Low Physical Activity on the Brain Alterations Related to Adverse Childhood Experiences
Lemye Zehirlioglu, Richard Okyere Nkrumah, Traute Demirakca, Gabriele Ende, Christian Schmahl
Multimodal neuroimaging: a step forward in our understanding of how adverse childhood experiences (ACE) affect the brain
Richard Okyere Nkrumah, Claudius von Schröder, Traute Demirakca, Christian Schmahl, Gabriele Ende
Neues aus der DeGPT-Arbeitsgruppe Akutpsychotraumatologie
Peter Schüßler, Julia SchellongHS D, Hof 10
Positionspapier der Deutschsprachigen Gesellschaft für Psychotraumatologie (DeGPT e.V.) zur Psychosozialen Akuthilfe sowie der mittel- und langfristigen psychosozialen Unterstützung von Betroffenen
Peter Schüßler
Qualitätsmanagement in Traumaambulanzen: Was können, was müssen Traumaambulanzen?
Julia Schellong, Anamaria Silva Saavedra
Angebot der Opferbeauftragten am Beispiel Baden-Württemberg
Jana Katharina Denkinger
Mikro-, Meso- und Makrofaktoren von Resilienz im Militär – ein systematisches Review
Gloria Ch. Straub, Wolfgang H. Prinz, Brigitte Lueger-Schuster
Correlates of risk-taking behaviour and suicidality among humanitarian aid workers
Hamed Seddighi
Was ist wann besonders relevant? Von der Methodik und Erfassung zu den vielfältigen gesundheitlichen Konsequenzen belastender Kindheitserfahrungen
Inga Schalinski, Florian JuenAula, Hof 1
Erfassung traumatischer Kindheitserfahrungen mithilfe des KERF-40+ Interviews: Einblicke aus Forschung und Praxis
Katja Seitz
Exploring Differential Effects of Severity and Timing of Early Adversity on Psychopathology in Young Adults with Previous Youth Residential Care Placements
Maria Meier, Inga Schalinski, Cyril Boonman, Marc Schmid, Eva Unternaehrer, David Bürgin
Vernachlässigung, Misshandlung und Symptombelastung in der Kindheit: Die Bedeutung von Alter, Art und Zeitpunkt in einer Hochrisiko Stichprobe
Florian Juen, Tobias Hecker, Katharin Hermenau, Inga Schalinski
Zeitpunkt und Dauer von Kindesmisshandlung und deren Zusammenhänge mit somatischen Erkrankungen im Erwachsenalter bei Frauen und Männern
Danielle Otten, Inga Schalinski, Jörg Fegert, Andreas Jud, Elmar Brähler, Vera Clemens
"Personalisierte Traumatherapie – Teamsache!"
Jochen Binder, Janina KowalskiSR 2, Hof 1
Das Weddinger Modell auf einer Traumatherapiestation: Effekte, Zufriedenheit und Ausblick des Weddinger Modells
Georgia Wendling-Platz, Lisa Rublein
Personalisierte Behandlung in der Hand der Fallführung – Ausnahmen sind die Regel?
Laura Pielmaier
Traumafachberater und Bezugspflege "zwischen den Stühlen" von miteinander nicht zu vereinbarenden Bedürfnissen
Daniel Trencev
"Der Fuss in der Türe": Wie die Kunsttherapie zur Förderung einer tragenden Patient:innenbeziehung mit dem Gesamtteam beitragen kann
Judith Zink
Unsere beste Option – die personalisierte Therapieplanung im multiprofessionellen Behandlungsteam
Janina Kowalski
Traumatherapie und Versorgung für Geflüchtete: Herausforderungen und Innovationen
Barbara Kasparik, Monja HeroldSR 3, Hof 7
Hinderliche Faktoren und Lösungsansätze bei der Umsetzung von Interventionen zur mentalen Gesundheit in Jugendhilfeeinrichtungen
Selina Kappler, Fabienne Hornfeck
Einstellungen gegenüber evidenzbasierten Methoden und Wissenszuwachs von Psychotherapeut:innen im Rahmen eines Weiterbildungsangebotes zur traumafokussierten kognitiven Verhaltenstherapie
Barbara Kasparik, Rebekka Eilers, Rita Rosner
One Year Follow-up of Post-traumatic Stress and Protective Factors of Interpreters Translating in Traumatherapy
Monja Herold, Lauritz Müller, Johanna Unterhitzenberger, Rita Rosner
Behandlung von Schlafstörungen nach Flucht und Traumatisierung – Ergebnisse einer randomisiert-kontrollierten Evaluation des Gruppen-Programms STARS (Sleep Training Adapted for Refugees)
Britta Dumser, Thomas Ehring, G.W. Werner, Theresa Koch
Traumadiagnostik, Traumatherapie und Traumapädagogik bei Menschen mit geistiger Beeinträchtigung: Aktueller Stand und neueste Entwicklungen
Birgit Mayer, Ulrich ElbingSR 1, Hof 1
Scoping Review Traumapädagogischer Konzepte für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung
Charlotte Boldt, Johannes Michalak, Ulrich Elbing
Diagnostik von Traumafolgestörungen bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung in Leichter Sprache
Birgit Mayer
Traumafokussierte Psychotherapie für Menschen mit Störung der Intelligenzentwicklung – auf dem Weg zur Inklusion in den Leitlinien
Marie Ilic, Tanja Sappok, Ulrich Elbing, Birgit Mayer
Was gibt es neues in der Traumapädagogik und traumazentrierten Fachberatung?
Marc Schmid, Lucas MaissenJosephinum, Währingerstr. 25
Wer macht warum eine zertifizierte Ausbildung in "Traumpädagogik / Traumazentrierte Fachberatung" und wie zufrieden sind die Absolvierenden?
Raphael Bermeitinger, Mara Terhoeven, Marc Schmid
Traumapädagogik in verschiedenen psychosozialen Handlungsfeldern
Marc Schmid, Birgit Lang, Bettina Breymaier, Christopher Kamen, Ute Ziegenhain, Martin Schroeder, Petra Wallnöfer
Mitarbeiterversorgung nach akuten Belastungssituationen in einem Übergangssetting für Jugendliche
Lucas Maissen, Irene Koch
13:30 - 14:15 Preisverleihung und Preisvorträge
Preisverleihung und Preisvorträge
HS C1, Hof 2
Verleihung folgender Preise
Forschungsförderungspreis der Elfriede Dietrich Stiftung
Förderpreis der Falk-von-Reichenbach Stiftung
Nachwuchspreis der Falk-von-Reichenbach Stiftung
Preis für Initiativen in der klinischen Praxis des Vereins GeTRA
sowie Vorträge der Preisträger:innen
14:30 - 16:00 Symposien 2
Neue Forschung zur Komplexen PTBS
Andreas Maercker, Brigitte Lueger-SchusterHS C1, Hof 2, Hörsaalzentrum
Das deutschsprachige International Trauma Interview (ITI) zur Erfassung von KPTBS und PTBS
Rahel Bachem, Andreas Maercker, Yafit Levin, Kai Köhler, Gerd Willmund, Stefanie Koglin, Manuel Stadtmann, Mareike Augsburger
Symptome des negativen Selbstkonzepts: eine «heikle» Angelegenheit für Soldat:innen
Wolfgang H. Prinz, Gloria C. Straub, Brigitte Lueger-Schuster
KPTBS – eine flukturierende Diagnose und Forschungen zu ihren Prädiktoren
Andreas Maercker, Myriam Thoma, Shauna Rohner, Milan Ruzmir
Behandlung mit dem Skills-Training zur Affektiven und interpersonellen Regulation (STAIR) im Gruppenformat – Befunde bei Patientinnen mit komplexer PTBS
Janine Borowski, Alina Momberger, Myrthe Klene, Ingo Schäfer
Trauma und Sexualität: Neues zu Ätiologie und Behandlung
Sarah Biedermann, Johanna SchröderHS C2, Hof 2, Hörsaalzentrum
Der Einfluss von Stigmatisierung auf die Entwicklung posttraumatischer Belastungssymptome nach sexuellem Kindesmissbrauch durch Frauen
Johanna Schröder, Leonard Kratzer, Peer Briken, Safiye Tozdan
Ätiologie und therapeutische Strategien bei Reviktimisierung nach sexuellem Missbrauch in der Kindheit
Stefan Tschöke
Sexuelle Funktionsstörungen bei Frauen mit PTBS nach sexuellem Missbrauch in der Kindheit und Jugend: Prävalenzen und klinische Korrelate
Meike Müller-Engelmann, Judith Weiß, Kathlen Priebe, Petra Lindauer, Nikolaus Kleindienst, Thomas Fydrich, Regina Steil
Trauma und Sexualfokussierte Therapie (TrUST): Evaluation eines Gruppenkonzepts für sexuelle Probleme nach interpersoneller Traumatisierung
Sarah Biedermann, Judith Gleixner
Minderjährige Geflüchtete – Psychische Belastung, Asylprozess und individuelle Therapievorstellungen
Maike Garbade, Cedric SachserHS A, Hof 2
Lebensqualität unbegleiteter minderjähriger Geflüchteter und die mediierende Rolle von Post-Migrationsstressoren & psychischer Belastung
Maike Garbade, Jenny Eglinsky, Selina Kappler, Cedric Sachser, Elisa Pfeiffer
Negative traumabezogene Kognitionen und PTBS-Symptome bei Arabisch-sprachigen geflüchteten Jugendlichen: eine Quer- und Längsschnittanalyse
Nadine Stammel, Lina Alhaddad, Celina Ruef, Caroline Meyer, Patricia Kanngießer, Christine Knaevelsrud
Mixed-Methods-Ansatz zur Analyse bedeutender Bedingungen im Asylprozess für die psychische Gesundheit von unbegleiteten jungen Geflüchteten in Deutschland
Fabienne Hornfeck, Selina Kappler
Chancen und Barrieren bei der Inanspruchnahme von Hilfsangeboten von traumatisierten unbegleiteten jungen Geflüchteten in Deutschland – eine qualitative Interviewstudie
Jenny Eglinsky, Maike Garbade, Luzie, Fritzsche, Elisa Pfeiffer, Cedric Sachser
Digitale Behandlungsansätze im Kontext von Krisen, Konflikt und Flucht
Laura Nohr, Rayan El-Haj-MohamadHS B, Hof 2
Wirksamkeit internetbasierter Interventionen für depressive Menschen in arabischsprachigen Ländern: Ergebnisse einer randomisierten Intervention
Rayan El-Haj-Mohamad, Jana Stein, Nadine Stammel, Yuriy Nesterko, Birgit Wagner, Christine Knaevelsrud, Maria Böttche
Digitale psychosoziale Unterstützung (Sui App) zur Verbesserung der Lebensqualität von arabischsprachigen Geflüchteten in der Schweiz: Ergebnisse einer randomisiert kontrollierten Studie
Rilana Stöckli, Viktoria Zöllner, Sebastian Burchert, Farhad Haji, Jessica Wabiszczewicz, Eva Heim, Christine Knaevelsrud, Thomas Berger
Bottom-up development of a culturally adapted internet-based self-help intervention for grieving Syrian refugees in Switzerland
Anaïs Aeschlimann, Eva Heim, Clare Killikelly, Nicola Buser, Anna Hoxha, Valentina Triantafyllidou, Andreas Maercker
Almamar – Erste Ergebnisse der Pilotstudie zur Wirksamkeit einer transdiagnostischen Intervention auf Arabisch und Farsi
Laura Nohr, Martina Hernek, Hannah Nilles, Nadine Stammel, Sebastian Burchert, Maria Böttche, Christine Knaevelsrud, Birgit Wagner, Johanna Böttcher
Versorgung von Gewaltbetroffenen in Traumaambulanzen – Ergebnisse des Forschungsverbundes „Projekt HilfT“
Ingo Schäfer, Miriam RassenhoferHS D, Hof 10
Projekt HilfT - Empfehlungen für eine flächendeckende Versorgung durch SER-Traumaambulanzen zur schnellen Hilfe für Opfer von Gewalttaten
Isabella Flatten-Whitehead, Marc Giessmann, Lina Specht, Julia Schellong, Ingo Schäfer, Miriam Rassenhofer
Herausforderungen bei der Vernetzung von Traumaambulanzen
Lina Specht, Isabella Flatten-Whitehead, Marc giessmann, Ingo Schäfer, Miriam Rassenhofer, Julia Schellong
Versorgung von Gewaltbetroffenen in Traumaambulanzen – Ergebnisse einer bundesweiten Befragung
Marc Giesmann, Lina Specht, Isabella Flatten-Whitehead, Miriam Rassenhofer, Julia Schellong, Ingo Schäfer
Einblicke in das Spannungsfeld Trauma und Justiz
Cornelia König, Elgin BröhmerAula, Hof 1
Strafverfahren: Akteure, Abläufe, Aufgaben
Elgin Bröhmer
Psychotherapie vor bzw. während strafrechtlicher Ermittlungen?!
Cornelia König
Grundzüge der Aussagepsychologie: Konsequenzen für psychotherapeutisches Vorgehen
Sandra Loohs
Als Psychotherapeutin/sachverständige Zeugin vor Gericht: was erwartet mich?
Kirsten Böök
Wertigkeit der PTBS in begutachtungsrelevanten Rechtsgebieten und der forensischen Psychiatrie - Implikationen für Diagnostik und Therapie in Gegenwart und Zukunft
Ralph-M. Schulte
Diversitätssensible Psychotraumatologie
Sinha Engel, Oswald D. KothgassnerSR 2, Hof 1
Moving beyond gender: Eine systematische Übersichtsarbeit zur Berücksichtigung von Diversität in der Psychotraumatologie
Stephanie Haering, Lars Schulze, Angelika Geiling, Caroline Meyer, Hannah Klusmann, Sarah Schumacher, Christine Knaevelsrud, Sinha Engel
Die Verarbeitung traumatischer Geburtserfahrungen aus einer intersektionalen Perspektive
Sinha Engel, Meike Katharina Blecker, Daria Dähn, Sarah Schumacher, Christine Knaevelsrud
Traumatische Kindheitserfahrungen als Vulnerabilitätsfaktor für depressive Symptome ein Jahr nach einer unbeabsichtigten Schwangerschaft – eine diversitätssensible Betrachtung
Meike Katharina Blecker, Stephanie Haering, Sinha Engel, Hannah Klusmann, Caroline Meyer, Sarah Schumacher, Christine Knaevelsrud
Traumatische Erfahrungen bei geschlechtsdysphorischen Jugendlichen – Ergebnisse der Wiener Studie und deren Implikationen für den Behandlungsprozess
Diana Klinger, Stefan Riedl, Sofia-Marie Oehlke, Heidi Elisabeth Zesch, Sabine Völkl-Kernstock, Paul Plener, Andreas Karwautz, Oswald D. Kothgassner
Traumatisierungserfahrungen in ehemaligen DDR-Heimen
Birgit Wagner, Heide GlaesmerSR 3, Hof 7
Psychische Belastungen bei Menschen mit DDR-Heimerfahrung – die Rolle von „Ethical Loneliness“
Doreen Hoffmann, Maya Böhm, Heide Glaesmer
Moralische Verletzung, PTBS und kPTBS nach Erfahrungen in DDR-Kinderheimen
Maya Böhm, Birgit Wagner
Therapieerfahrungen von Betroffenen aus ehemaligen Kinderheimen oder Jugendwerkhöfen der DDR
Emelie Compera, Doreen Hoffmann, Maya Böhm, Heide Glaesmer
Internetbasierte Imagery Rescripting Intervention für ehemalige Betroffene mit DDR-Heimerfahrung: Eine randomisierte Kontrollgruppenstudie
Birgit Wagner, Raphaela Grafiadeli, Maya Böhm
Traumaspezifische Akutbetreuung von Kindern und Bezugspersonen nach Suizid/-versuch und Tötung/-sversuch im persönlichen Umfeld
Simon Finkeldei, Susanna Rinne-WolfSR 1, Hof 1
Unterstützung von Kindern und Bezugspersonen nach einem Suizid/-versuch oder Tötung/-sversuch im persönlichen Umfeld – was berichten die Versorgenden?
Simon Finkeldei
Unterstützung von Kindern und Bezugspersonen nach einem Suizid/-versuch oder Tötung/-sversuch im persönlichen Umfeld – was berichten die Betroffenen?
Susanna Rinne-Wolf
Unterstützung von Kindern und Bezugspersonen nach einem Suizid/-versuch im persönlichen Umfeld - Was folgt für die Praxis? Vorstellung ausgewählter Interventionsschwerpunkte und Materialien
Tita Kern
Befürchtungen von Fachkräften in der Versorgung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Traumafolgestörungen
Katharina Szota, Anne GrassJosephinum, Währinger Str. 25
Welche Befürchtungen, Belastungsfaktoren und Bedürfnisse berichten Fachkräfte bei der Versorgung traumatisierter Kinder und Jugendlicher?
Katharina Szota
Gibt es Unterschiede in den Schwierigkeiten in der psychotherapeutischen Praxis zwischen der Behandlung von PTBS und der Behandlung von psychischen Erkrankungen im Allgemeinen?
Katharina Gossmann
Kommt es bei jugendlichen PTBS-Patient:innen während traumafokussierter Psychotherapie zu einer Zunahme von Problemverhalten?
Anne Grass
Macht, Ohnmacht und Machtmissbrauch – Gefahren in der Suche nach Sicherheit
Daniel Dietrich
16:30 - 18:00 Vorträge, Keynote Speaker
Trauma and the Brain: Bridging the Gap Between Neuroscience and Clinical Practice
Pia PechtelC1, Hof 2, Hörsaalzentrum
Over the last 20 years, neurobiological research has critically advanced our understanding of the impact of childhood trauma on brain development. Despite the substantial progress, a gap remains in how this important research translates into diverse clinical frontline work for children, youth, and families. Such translational information may be vital for identifying mechanisms of change in effective treatment approaches and for developing novel clinical interventions.
The current talk aims to bridge the gap between research and clinical practice by extracting key guiding principles from the last two decades of neurobiological research on trauma to critically evaluate their role in established evidence-based trauma interventions (e.g., posttraumatic stress disorder), in complex trauma-related presentations (high-risk behaviours: e.g., non-suicidal self-injury) and in promoting resilience across the life span (e.g., social connectedness).
In addition to other seminal research, Dr. Pechtel will draw on her own multimodal research program using primarily functional magnetic resonance imaging and EEG as well as provide examples of how such findings have guided the development of novel therapeutic approaches for youth who experienced childhood trauma.
Behandlung diverser Populationen
Malek BajboujHS C1, Hof 2, Hörsaalzentrum
Die stratifizierte, personalisierte oder individualisierte Behandlung ist eines der am weitesten verbreiteten Versprechen der heutigen Medizin und Psychologie. Vergleichbar mit in Teilen erfolgreichen Strategien in der Onkologie, fokussieren die allermeisten Personalisierungsansätze auch in anderen Disziplinen auf der Identifikation von Mustern auf der Basis von biologischen Markern aus Bildgebung, digitaler Sensorik, Genetik oder Metabolomics.
Insbesondere in der Diagnostik und Therapie von stress- und traumabezogenen Erkrankungen sind neben diesen vielversprechenden biologisch orientierten Ansätzen die Berücksichtigung von klinischen und soziodemographischen Faktoren sowie von Umgebungsfaktoren mindestens ebenso bedeutsam. Unterschiede von Individuen bestehen nicht nur in funktionellen oder strukturellen Bildgebungsbefunden, sondern viel häufiger in klinischen Phänotypen, individuellen Persönlichkeitsmerkmalen und unterschiedlichen Arten von erlebten Stressoren oder Traumata. Eine profunde Kenntnis über diese individuellen Faktoren stellt die Grundlage für klinisch, soziodemographisch und durch Umgebungsfaktoren informierte Klassifikationen diverser oder heterogener klinischer Populationen dar. Diese durch das Exposom, kulturelle Umgebungen und (tiefe) Phänotypisierung informierte Klassifikation wiederum ist notwendige Basis für die dringend notwendige Individualisierung von Behandlungen von Stress und Traumafolgestörungen.
In diesem Vortrag sollen aus Erfahrungen, die in mehreren internationalen Sprechstunden an der Charité – Universitätsmedizin Berlin sowie in einer Vielzahl von humanitären Projekten im Mittleren Osten, in Fernost und in der Ukraine gewonnen wurden, Empfehlungen für spezifische Interventionen abgeleitet werden, in denen Individualisierung von Behandlungen für diverse und heterogene Populationen über die Berücksichtigung von Exposom, Kultur und Phänotypisierung geschieht. Diese umfassen unter anderem die Entwicklung von Interventionen für ukrainische Mütter in Kriegsgebieten, die Etablierung von psychotherapeutischen Interventionen mit Thematisierung von Individualisierung versus Gruppenzugehörigkeit in Vietnam oder maßgeschneiderte Psychoedukationsformate für arabisch sprechende Patientinnen und Patienten. Die diskutierten Interventionen und Behandlungen umfassen neben klassischen psychotherapeutischen Ansätzen um Einzel- und Gruppensetting auch Peer to Peer Ansätze sowie mehrere digitale Anwendungen wie Chatbots zur psychologischen ersten Hilfe, Avatar-basierte Psychoedukation sowie digitale Gesundheitsanwendungen. Schließlich wird in dem Vortrag als Strategie zur weiteren Individualisierung die Integration der Interventionen in einem übergreifenden Behandlungsmodell (stepped and collaborative care model) vorgeschlagen.
18:15 - 19:30 DeGPT-Mitgliederversammlung
DeGPT-Mitgliederversammlung
Josephinum, Währingerstr. 25
18.15 Uhr
DeGPT-Mitgliederversammlung
Diese Veranstaltung ist nicht öffentlich! Der Zugang ist nur Mitglieder:innen der DeGPT gestattet.
20:00 - 23:00 Tagungsfest
Tagungsfest
Rahlgasse 5, 1060 Wien
Restaurant Aux Gazelles
Kosten: 85 € pro Person
Verbindliche Anmeldung erforderlich
Weitere Informationen unter dem Menüpunkt Rahmenprogramm
Samstag 24 Feb 2024
9:00 - 10:30 Vorträge, Keynote Speaker
Evidenzbasierte Personalisierung in der Behandlung psychischer Störungen – wo stehen wir und wo wollen wir hin?
Wolfgang LutzHS C1, Hof 2, Hörsaalzentrum
Psychotherapie ist eine wirksame Behandlung bei psychischen Störungen und häufig psychopharmakologischen Interventionen überlegen. Aber eine Vielzahl von zum Teil originellen und beliebten Neuentwicklungen psychotherapeutischer Verfahren steht eine geringe differentielle Evidenz im Vergleich zu bereits etablierten Verfahren gegenüber. Ein wichtiges Ziel der Psychotherapie und Psychotherapieforschung sollte es daher sein, sich von einer Orientierung an Therapieschulen hin zu einer Orientierung an Therapieergebnissen zu entwickeln und insbesondere die Behandlung in der Praxis zu verbessern, die aus Psychotherapie zunächst keinen Nutzen ziehen. Dazu ist eine Entwicklung hin zu einer Patienten- und Erfolgsorientierung in der Psychotherapie und Psychotherapieforschung nötig sowie deren Anwendung in der Praxis. Hierzu gehören Fragen wie: Welche therapeutischen Strategien sind für welche Patient:innen mit welcher psychischen Störung am erfolgsversprechendsten? Und, wie können therapeutische Strategien optimal im Laufe der Behandlung an die Bedürfnisse der Patient:innen angepasst werden, insbesondere bei Patient:innen mit einem Risiko für ein negatives Therapieergebnis oder einen Therapieabbruch?
In diesem Vortrag werden Entwicklungen zu einer evidenzbasierten und personalisierten Psychotherapie(forschung) vorgestellt und Implikationen für die klinische Praxis und die zukünftige psychotherapeutische Aus- und Weiterbildung aufgezeigt.
Traumatherapie im Kindes- und Jugendalter – aktuelle evidenzbasierte Verfahren und individuelle Bedürfnisse der Patient:innen
Elisa PfeifferHS C1, Hof 2, Hörsaalzentrum
In den letzten Jahrzehnten konnte ein starker Anstieg an internationaler Forschung zur Entwicklung und Evaluation von traumatherapeutischen Verfahren speziell für Kinder und Jugendliche mit Traumafolgestörungen verzeichnet werden. Viele der Verfahren sind stark standardisiert und manualisiert, folgen einem „one-size-fits-all“ Ansatz und gehen nur begrenzt auf individuelle Bedürfnisse/Symptomatik der Patientinnen und Patienten ein. Trotz der guten Evidenzbasis und großen Effektstärken profitiert ein Teil der behandelten Kindern und Jugendlichen nicht ausreichend (non-response) oder bricht die Therapie ab (Drop-out), was für eine stärkere Individualisierung der Therapie spricht.
In diesem Vortrag werden zunächst aktuelle evidenzbasierte traumafokussierte Verfahren für das Kindes- und Jugendalter mit Fokus auf deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede vorgestellt. Aktuelle Trends und Entwicklungen wie massierte traumatherapeutische Verfahren werden diskutiert. Herausforderungen der evidenzbasierten Verfahren wie Drop-Outs oder eine fehlende Dissemination im deutschsprachigen Raum werden erörtert.
Im zweiten Teil des Vortrags werden individuelle Bedürfnisse traumatisierter Kinder und Jugendlicher dargestellt, um schließlich zur Frage zu kommen, inwiefern evidenzbasierte Verfahren einer stärkeren Individualisierung bedürfen. Abschließend werden Implikationen für die Psychotherapieforschung und die klinische Praxis aufgezeigt.
11:00 - 12:30 Symposien 3
Dissoziative Identitätsstörung und rituelle Gewalt: Fakten und Fiktionen
Kathlen Priebe, Stefan RöpkeHS C1, Hof 2, Hörsaalzentrum
Rituelle Gewalt – Herausforderung für Therapie und Beratung
Axel Seegers
Die dissoziative Identitätsstörung – historische Entwicklung und Definition
Stefan Röpke
Die dissoziative Identitätsstörung – empirische Befunde
Kathlen Priebe
Scheinerinnerungen und Suggestion in der Psychotherapie
Renate Volbert
Personalisierte Traumatherapie im Kindes- und Jugendalter: Wo stehen wir und wie können wir eine stärkere Individualisierung erreichen?
Anke de Haan, N.N.HS C2, Hof 2, Hörsaalzentrum
Individualisierte Traumatherapie für Kinder und Jugendliche: Eine systematische Übersichtsarbeit
Sarah K. Schäfer, Max Supke, Lea Thomas, Aylin Schumann, Klaus Lieb
Wirksamkeit und Moderatoren der Wirksamkeit von traumafokussierten kognitiven Verhaltenstherapien bei Kindern und Jugendlichen: Eine individual participant data meta-analysis
Anke de Haan
Mobbing und posttraumatische Stresssymptome bei Kindern und Jugendlichen: Ist es Zeit, das A-Kriterium aus einer Entwicklungsperspektive zu überdenken?
Cedric Sachser, Jacob Segler, Lucy Berliner, Rita Rosner, Elisa Pfeiffer, Marianne Birkeland, Tine Jensen
KI-gestützte Erfassung flexibler Emotionsregulation: Anwendbarkeit und Zusammenhang mit klinischen Zielparametern bei Jugendlichen
Ann-Christin Haag, Rohini Bagrodia, Tanya Sharma, George A. Bonanno
Sexualisierte Gewalterfahrung in Risikopopulationen – Geschlechtsspezifika, Häufigkeit, Folgen und Behandlungsperspektiven
Yuriy Nesterko, Heide GlaesmerHS A, Hof 2
Sexualisierte Gewalterfahrungen in der Kindheit bei weiblichen Inhaftierten und deren Bedeutung für Kriminalitätsfaktoren und die Gestaltung von Resozialisierungsmaßnahmen
Susanne Deitert, Heide Glaesmer
Sexualisierte Gewalt und psychische Belastungen bei Geflüchteten mit LGBIQ+-Hintergrund
Heide Glaesmer, Kim Hella Schönenberg, Yuriy Nesterko
Offenlegungsprozesse kriegs- und vertreibungsbezogener sexualisierter Gewalt bei männlichen Überlebenden
Kim Hella Schönenberg, Heide Glaesmer, Yuriy Nesterko
Hürden und Fazilitatoren für die Inanspruchnahme professioneller Versorgungsangebote nach erfahrener sexueller Gewalt aus Betroffenenperspektive
Marie Kaiser, Heide Glaesmer
Interventionen für Kinder und Jugendliche in Fremdunterbringung
Lucia Emmerich, Birgit WagnerHS B, Hof 2
Polyviktimisierung bei Kindern in Fremdunterbringung: Wie hängen vergangene (Beziehungs-) Erfahrungen mit der gegenwärtigen Eltern-Kind-Beziehung zusammen?
Nina Heinrichs, Antonia Brühl
Viktimisierungserfahrungen bei Kindern und Jugendlichen in Fremdunterbringung alltagsnah erfassen: Was können wir von Smartphone-basierten Erhebungen lernen?
Kerstin Konrad, Maren Boecker, Marco Giurgiu, Ulrich Ebner-Priemer, Sophie Niestroj
Eine internetbasierte Intervention gegen Reviktimisierung für Jugendliche und junge Erwachsene in Fremdunterbringung: Erste Ergebnisse einer randomisierten Kontrollgruppenstudie
Betteke van Noort, Lucia Emmerich, Birgit Wagner
Biografiearbeit für fremduntergebrachte Jugendliche – Ergebnisse der Pilotstudie zur Gruppenintervention ANKOMMEN
Miriam Rassenhofer, Jörg M. Fegert, Steffen Schepp, Andreas Witt, Elisa Pfeiffer
Long-term consequences of (welfare-related) child maltreatment: An international perspective with survivors from Austria, Germany, Switzerland, and Ireland
Shauna L. Rohner, Myriam V. ThomaHS D, Hof 10
Long-term physical and mental health correlates of early-life compulsory social measures and/or placements in Swiss survivors of advanced age
Myriam V. Thoma, Florence Bernays, Andreas Maercker, Shauna L. Rohner
Suicidality of people with experiences in youth welfare institutions of the GDR – During and after residential care
Doreen Hoffmann, Maya Böhm, Heide Glaesmer
Aspects of social support and disclosure in the context of institutional abuse – Long-term impact on mental health
Brigitte Lueger-Schuster, Asisa Butollo, Yvonne Moy, Reinhold Jagsch, Tobias Glück, Viktoria Kantor, Matthias Knefel, Dina Weindl
Childhood maltreatment and later life prosocial behaviour: A qualitative investigation with institutional and familial abuse survivors
Shauna L. Rohner, Aileen N. Salas Castillo, Alan Carr, Myriam V. Thoma
Forschung im Kontext von Psychosozialen Zentren (PSZ) – Erkenntnisse für Wissenschaft und Praxis
Maya Böhm, Theresa KochAula, Hof 1
Psychodiagnostik in der psychosozialen Versorgung geflüchteter Menschen: Was sind die aktuellen Herausforderungen und wie können sie überwunden werden?
Amelie Pettrich, Yuriy Nesterko, Elisa Rimek, Heide Glaesmer
Verfügbarkeit und Durchführbarkeit von Behandlungen mit Geflüchteten im klinischen Routinesetting: Daten zum Patient:innen-Flow sowie zu Therapiedropout bei Refugio München
Theresa Koch
Entwicklung und Validierung eines Fragebogens zur Erfassung von Rollenkonflikten bei Dolmetschenden in der Arbeit mit geflüchteten Menschen – Der Rollenkonflikt-Fragebogen (RoKo)
Angelika Geiling, Laura Nohr, Caroline Meyer, Maria Böttche, Christine Knaevelsrud, Nadine Stammel
„Kräfte stärken – Trauma bewältigen“: Skill-training in Erstsprachen als niedrigschwellige Möglichkeit zur Traumabewältigung und Emotionsregulation bei geflüchteten Schüler:innen in Wien
Sabine Kampmüller
Traumaerfahrungen vor und in der Peripartalzeit: die Rolle des Stresssystems und Implikationen für Bindungsfähigkeit und Behandlungspräferenzen
Julia Schellong, Lara SeefeldSR 2, Hof 1
Auswirkung mütterlicher Misshandlung in der Kindheit auf die Mutter-Kind-Bindung nach der Geburt und Glukokortikoide im Haar
Luisa Bergunde, Marlene Karl, Miriam Borrmeister, Isabel Jaramillo, Victoria Weise, Judith T. Mack, Kerstin Weidner, Wei Gao, Susann Steudte-Schmiedgen, Susan Garthus-Niegel
Geburtsbezogene PTBS-Symptome und Eltern-Kind-Bindung bei Müttern und Vätern und die mediierende Rolle des Stillens: Ergebnisse einer prospektiven Kohortenstudie
Victoria Weise, Tilman von Soest, Lara Seefeld, Pauline Wimberger, Julia Martini, Eva Asselmann, Susan Garthus-Niegel
Behandlungs- und Beratungspräferenzen sowie -barrieren von postpartalen Frauen mit Symptomen einer (geburtsbezogenen) PTBS und Erfahrungen von Partnerschaftsgewalt
Lara Seefeld, Valentina Jehn, Laura Hausmann, Amera Mojahed, Susan Garthus-Niegel, Julia Schelllong
Diagnostik und Prozesse in der Traumatisierung
Oswald D. Kothgassner, Silvia GradlSR 3, Hof 7
Die Rolle negativer posttraumatischer Kognitionen bei der Behandlung von Patient:innen mit posttraumatischer Belastungsstörung
Silvia Gradl, Juliane Burghardt, Claudia Oppenauer, Manuel Sprung
Zur Bedeutung von Erinnerungsfragmentierung in der psychotherapeutischen Arbeit mit PTBS-Patient:innen: Vorläufige Ergebnisse der MemFraT-Studie
Lina Krakau, Rayan El-Haj-Mohamad, Laura Nohr, Matthias F.J. Sperl
Einführung in die Ressourcenfokussierte Traumaanamnese (RFTA) in der Behandlung komplextraumatisierter Patient:innen
Steffen Bambach
Die Inhibitionstheorie: Entwicklung von Glück und Zufriedenheit nach einschneidenden Lebensereignissen (Querschnittslähmung) – eine qualitative Exploration des Zufriedenheitsparadoxons
Tanja Ecken, Laura Fricke
Entwicklung und Validierung des International Trauma Questionnaire – Caregiver (ITQ-CG): Erfassung der (K)PTBS nach ICD-11 bei Kindern und Jugendlichen aus Fremdperspektive
Alexander Haselgruber, Dina Weindl, Brigitte Lueger-Schuster
Durch qualitative Forschung in der Psychotraumatologie die transformative personalisierte Therapie stärken
Jochen Binder, Manuel StadtmannSR 1, Hof 1
Erfahrungen und Wahrnehmungen von ambulanten Patienten im Rahmen der pferdegestützten Psychotherapie - eine phänomenologische Studie
Sibylle Müller, Jochen Binder, Flavio Heller, Manuel Stadtmann
Der Hund als Medium für eine gelingende Beziehungsaufnahme in der Traumatherapie: Eine qualitative inhaltsanalytische Untersuchung
Ronja Dieterle, Jochen Binder, Flavio Heller, Manuel Stadtmann
Die Entwicklung eines gruppentherapeutischen Angebotes für die Tagesklinik für Traumafolgestörungen: Eine Co Creation Methodologie
Manuel Stadtmann, Flavio Heller, Christoph Jans, Jochen Binder
Misshandlungs- und Vernachlässigungserfahrungen im Kindes- und Jugendalter: Verläufe, Lebensqualität, Resilienz
Katharina Beck, Julia QuehenbergerAlte Kapelle, Hof 1
Emotionale Misshandlung: Verschiedene Erscheinungsformen und Expositionsfaktoren
Meret Wallimann, Julia Quehenberger, David Lätsch
Die Rolle der Selbstwirksamkeit in der Assoziation zwischen früheren Misshandlungs- und Vernachlässigungserfahrungen und späterer Lebensqualität bei ehemals fremdplatzierten jungen Erwachsenen
Milou Leiting, David Bürgin, Katharina Beck, Jörg M. Fegert, Nils Jenkel, Cyril Boonmann, Klaus Schmeck, Marc Schmid
Selbstwirksamkeit, beeinträchtigte Persönlichkeitsfunktionen und soziale Unterstützung sagen Residualresilienz in ehemals fremdplatzierten jungen Erwachsenen vorher
Clara von Wendorff, Maria Meier, David Bürgin, Marc Schmid, Vera Clemens
Exploring age-related subgroups of different types of maltreatment across childhood – Findings in young adults with previous youth residential care placements
Anais Gasser, David Bürgin, Jörg M. Fegert, Nils Jenkel, Cyril Boonmann, Klaus Schmeck, Marc Schmid
13:00 - 14:00 Postersession
Postersession
N.N.HS C1/C2, Hof 2, Hörsaalzentrum
Poster 1
Differenzielle Assoziationen zwischen belastenden Kindheitserfahrungen und Kompetenzen der Emotionsregulation
Sandra Miethe, Janna Wigger, Pauline Althoff, Sebastian Trautmann
Poster 2
Die Erfassung von PTBS-bezogener funktioneller Beeinträchtigung bei trauma-exponierten Kindern und Jugendlichen: Eine systematische Übersichtsarbeit
Vogt, Alexandra J., Markus A. Landolt, Elisa Pfeiffer, Cedric Sachser, Ingeborg Skjærvø, Lasse Bartels
Poster 3
Prävalenz der Anhaltenden Trauerstörung bei Patient:innen in stationärer, psychiatrischer Behandlung
Mirjam Sophie Rüger, Franziska Lechner-Meichsner, Lotte Kirschbaum, Silke Lubik, Sibylle C. Roll, Regina Steil
Poster 4
Prävalenz, Kumulation und Geschlechtsunterschiede potenziell traumatischer Ereignisse bei jungen erwachsenen Care-Leavern – Befunde aus der schweizweiten JAEL-Studie
Laura Gurri, Marc Schmid, Jörg M. Fegert, Nils Jenkel, Cyril Boonmann, Klaus Schmeck, David Bürgin
Poster 5
Suizidalität bei unbegleiteten jungen Geflüchteten in Deutschland, Prävalenz und Risikofaktoren
Jacob Segler, Jenny Eglinsky, Maike Garbade, Elisa Pfeiffer, Cedric Sachser
Poster 6
Traumatische Geburtserfahrungen: sagen ‚hotspots‘ während der Geburt geburtsbezogenen posttraumatischen Stress vorher?
Meike Katharina Blecker, Daria Dähn, Sinha Engel, Christine Knaevelsrud, Sarah Schumacher
Poster 7
Traumafolgestörungen und komplexe dissoziative Störungen bei Geflüchteten – Prävalenz und Begleiterscheinungen
Daniela Dührkoop, Cosima Rhein, Elif Kirmizi Alsan, Bettina Böhm, Eva Morawa, Yesim Erim, Eva Schäflein
Poster 8
Die Prävalenz von traumatischen Ereignissen, PTBS, Depressionen, Ängsten und Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen in der Fremdunterbringung – systematisches Review und Meta-Analyse
Loni Dörrie, Jessica Köksal, Jacob Segler, Cedric Sachser, Elisa Pfeiffer
Poster 9
Die Rolle der Endocannabinoid-Konzentration im Haar bei klinischen Symptomen und Behandlungsergebnissen bei stationären PTBS-Patientinnen
Luisa Bergunde, Marcella L. Woud, Lorika Shkreli, Lena Schindler-Gmelch, Susan Garthus-Niegel, Simon E. Blackwell, Henrik Kessler, Clemens Kirschbaum, Susann Steudte-Schmiedgen
Poster 10
Interpersonelle bio-behaviorale Synchronizität bei Jugendlichen mit posttraumatischer Belastungsstörung im Verlauf einer traumafokussierten kognitiven Verhaltenstherapie: Studienprotokoll
Sarah Macura, Paul Plener, Oswald Kothgassner
Poster 11
Das Somatische Narrativ - dimensionale Erweiterung und Methode
Walter Schurig
Poster 12
DBT-Traumatherapie bei einer Patientin mit kPTBS und schwerer dissoziativer Identitätsstörung
Stefanie Wekenmann
Poster 13
Misophonie, eine Traumafolgestörung?
Verena Hein
Poster 14
Prävalenz und Diagnoseverhalten bei Posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) in der Somatik
Markus Stingl, Bernd Hanewald
Poster 15
Akuthilfe für geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine - Pilotstudie zur Evaluation des pädagogischen Gruppenangebots „AKUT“
Marie Anaïs Zottnick, Jan Felix Odenthal
Poster 16
Metabolomics: Potential Future Avenues for Biomarker Research in PTSD
J. Schwarzenberg, C. Scharinger, S. Aurich, P. Plener, C. Gerner
Poster 17
Wie können wir die Behandlung von PTBS im Alter mit Narrativer Expositionstherapie personalisieren?
Jeannette Lely
14:15 - 15:45 Symposien 4
Psychosoziale Belastungen von ukrainischen Geflüchteten und Interventionen für Kinder, Studierende, Familien und Therapeut:innen innerhalb und außerhalb der Ukraine
Cedric Sachser, Elisa PfeifferHS C1, Hof 2, Hörsaalzentrum
Psychische Belastungs- und Resilienzfaktoren von Geflüchteten aus der Ukraine – Eine Studie unter behandlungsaufsuchenden Menschen im Mental Health Center Ukraine
Jewgenija Korman, Anastasiia Burdym, Theresa Koch
Mein Weg – traumafokussiertes Gruppenmentoring für Studienanfänger:innen aus der Ukraine
Brigitte Lueger-Schuster, Theresa Wagner, Thorsten Sukale, Elisa Pfeiffer
„TF-CBT Ukraine“- Evaluation der Implementierung einer evidenzbasierten Traumatherapie für Kinder und Jugendliche in der Ukraine während des Krieges
Elisa Pfeiffer, Maike Garbade, Cedric Sachser, Vitalii Klymchuk
PRACTICE Makes Progress – Evidenzbasiertes Selbstfürsorge-Programm für Ukrainische Therapeut:innen während des Krieges
Fabienne Krech, Maike Garbade, Elisa Pfeiffer, Beth Cooper, Elisabeth Pollio, Esther Deblinger
DBT-PTBS: Neue Entwicklungen und Forschungsergebnisse
Claudia Oppenauer, Oswald D. KothgassnerHS C2, Hof 2, Hörsaalzentrum
Weiterentwicklungen in der DBT für Erwachsene – Traumafokussierte Therapie der Borderline Persönlichkeitsstörung
Miriam Biermann, Christian Schmahl, Martin Bohus, Ruben Vonderlin, Nikolaus Kleindienst
DBT-PTBS in der Adoleszenz
Christian Schmahl, Sven Cornelisse, Miriam Biermann, Frank Enning, Nikolaus Kleindienst
Transfer der DBT-PTBS in den klinischen Alltag
Claudia Oppenauer, Manuel Sprung, Silvia Gradl, Juliane Burghardt
Ein systematischer und meta-analytischer Überblick zur Dialektischen Verhaltenstherapie bei posttraumatischer Belastungsstörung
Oswald D. Kothgassner, Karin Prillinger, Claudia Oppenauer, Andreas Goreis, Carola Hajek Gross, Annika Lozar, Selina Fanninger, Anna Mayer, Sarah Macura, Paul Plener
Betroffene berichten von Gewalt: Herausforderungen in Diagnostik, Forschung und Praxis und deren Einbettung im aktuellen wissenschaftlichen und öffentlichen Diskurs
Jan Gysi, Ursula GastHS A, Hof 2
Der Ausgangspunkt: Betroffene erzählen – Erfahrungen der Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs mit organisierter sexualisierter und ritueller Gewalt
Silke Gahleitner
Herausforderungen in der Diagnostik der Dissoziative Identitätsstörung: Falsch-negative und falsch-positive Diagnosen
Ursula Gast
Artifizielle Erinnerungen, Falschbeschuldigungen und falsches Zweifeln
Jan Gysi
Unterschiedliche Definitionen, psychotherapeutische Über- und Unterbetonungen und Wissensdefizite zu organisierten Gewaltformen
Susanne Nick
Trauma und Stressbewältigung bei Vorschulkindern: Aktuelle Erkentnisse über Symptomatik, Risikofaktoren und Traumabehandlung
Mira Vasileva, Franka Metzner-GuczkaHS B, Hof 2
Stressbezogene Kognitionen im Vorschulalter und ihr Zusammenhang mit psychischen Auffälligkeiten
Mira Vasileva
DSM-5 PTBS-Symptome und funktionelle Beeinträchtigung bei trauma-exponierten Vorschulkindern: Ein Netzwerkansatz
Lasse Bartels, Markus A. Landolt, Lucy Berliner, Cedric Sachser
Prä-Post-Studie zur Bewertung einer EMDR-basierten Gruppentherapie für traumatisierte Flüchtlingskinder im Vorschulalter in Kindertagesstätten
Franka Metzner-Guczka, Daniela Lempertz, Kerstin Stellermann-Strehlow, Michelle Wichmann, Silke Pawils
Personalisierter Weg durch das Hilfesystem nach sexuellen Kindesmissbrauchserfahrungen
Miriam Rassenhofer, Jelena GerkeHS D, Hof 10
Aus der Praxis: Das Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch – Beratung als Puzzleteil einer interdisziplinären personalisierten Unterstützung für Betroffene und Dritte
Merle Frey
„Ich suche etwas, was mir wirklich hilft!“ – Einflüsse von Geschlecht und Lebensumfeld von Betroffenen auf den Erhalt professioneller Hilfe
Frederike-Kristina Mattstedt, Jelena Gerke, Miriam Rassenhofer
Auf der Suche nach professioneller Hilfe – Einfluss des Täter:innengeschlechts
Jelena Gerke, Frederike-Kristina Mattstedt, Miriam Rassenhofer
Mein Weg durchs OEG | Kooperationsprojekt. Eine betroffeneninitiierte Online-Umfrage zum Antrags- und Prüfverfahren im Rahmen des Opferentschädigungsgesetz (OEG) für Gewaltopfer
Isabella Flatten-Whitehead, Frau Rapunzel, Gudrun Stifter, Ingo Fock, Miriam Rassenhofer, Jörg M. Fegert
Akkulturation und psychische Gesundheit im Kontext von Flucht
Caroline Meyer, Nadine StammelAula, Hof 1
Akkulturation von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten und mögliche Einflussfaktoren
Maike Garbade, Jenny Eglinsky, Heinz Kindler, Rita Rosner, Cedric Sachser, Elisa Pfeiffer
With a little help from my friends? Akkulturation and psychische Gesundheit bei arabischsprachigen Jugendlichen mit Fluchterfahrung
Caroline Meyer, Lina Alhaddad, Nadine Stammel, Frederick Sixtus, Jenny Sarah Wesche, Rudolf Kerschreiter, Patricia Kanngießer, Christine Knaevelsrud
Akkulturationsstrategien, wahrgenommene Diskriminierung und Lebenszufriedenheit bei Leipzigerinnen syrischer Nationalität
Yuriy Nesterko, Kim Schöneberg, Heide Glaesmer
“Can you hear me?” Muffled Voices Despite Open Ears
Mariam Fishere
Der Beitrag musste leider unvorhergesehen abgesagt werden
Gilt das Menschenrecht auf Gesundheitsversorgung universell? Ein Beitrag aus traumatherapeutischer Sicht
Markus Stingl, Bernd Hanewald
Trauma bei Minderjährigen
Paul Plener, Johanna UnterhitzenbergerSR 2, Hof 1
Dissemination und Implementierung von TF-KVT mit Kindern und Jugendlichen in sieben europäischen Ländern
Johanna Unterhitzenberger, Pia Enderby, Tine Jensen, Aino Juusola, Zlatina Kostova, Ramon Lindauer, Sanna-Kaija Nuotio, Poa Samuelberg, Elisa Pfeiffer
CBITS – Evaluation der „Kognitiven Behavioralen Intervention für Trauma in Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen in Deutschland“ – eine randomisierte kontrollierte Studie
Jessica Köksal, Loni Dörrie, Cedric Sachser, Elisa Pfeiffer
Interdisziplinäre Kooperation zur Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Traumafolgestörungen
Katharina Szota, Rieka Kamps, Hanna Christiansen
Viktimisierungserfahrung und posttraumatische Belastungssymptome bei Kindern und Jugendlichen in Fremdunterbringung: Die mediierende Rolle von Mentalisierung
Lucia Emmerich, Betteke van Noort, Birgit Wagner
Interdisziplinäre Versorgung von Kindern, Jugendlichen und Familien mit Fluchterfahrung in Erstunterkünften
Andrea Hahnefeld, Matthias Klosinski
Traumafolgestörungen bei Geflüchteten – Prävalenz und Zugang zur Versorgung
Annett Lotzin, Ingo SchäferSR 3, Hof 7
Kriegsbezogene Stressoren und (komplexe) posttraumatische Belastungsstörungen während des russischen Krieges in der Ukraine
Annett Lotzin, Lisa Schratz, Antje Paetow, Olga Morozova-Larina, Vladyslava Keller, Liudmyla Krupelnytska
Zugang zu psychischer Gesundheitsversorgung bei syrischen Geflüchteten in Leipzig
Kim Schönenberg, Yuriy Nesterko, Heide Glaesmer
Die Evaluierung des Versorgungsmodells „Koordinierte Behandlung unter Einbezug von Gesundheitspatient:innen“ (KOBEG) für psychisch belastete Geflüchtete: Zwischenergebnisse des laufenden RCTs
Michael Odenwald, Leonie Lipinski, Marius Grimm, Brigitte Rockstroh, Daniela Mier, Lea Bogatzki
Entwicklung und Erprobung eines Trainings-Curriculums zur Peer-gestützten psychosozialen Unterstützung traumatisierter Geflüchteter
Ingo Schäfer, Anna Berckhemer, Lena Nugent, Rebecca Nixdorf, Yuriy Nesterko, Heide Glaesmer, Fabienne Führmann, Iris Graef-Calliess, Candelaria Mahlke, Annett Lotzin
Nachwuchsforscher:innen
Birgit Kleim, Matthias KnefelSR 1, Hof 1
Kann eine neue Lebenssinn-fokussierte Intervention psychische Belastungssymptome nach einem aversiven Film reduzieren?
Lea-Jasmin Seidel-Koulaxis
Der Einfluss des Oxytocinsystems auf die Acquisition und Konsolidierung von intrusiven Erinnerungen nach einem Traumafilm
Tolou Maslahati, Katharina Schultebraucks, Katja Wingenfeld, Christian Otte, Milagros Galve, Julian Hellmann-Regen, Stephan Ripe, Stefan Roepke
Schlaf verstärkt die Abnahme der PTBS-Symptome bei stationären Patient:innen nach einer traumafokussierten Intervention
Laura Meister, Alex Rosi-Andersen, Yasmine Azza, Natalie Muellner, Michael Colla, Erich Seifritz, Steven Brown, Birgit Kleim
Predicting Intrusive Memories Through Trauma Narratives in PTSDValerie Hofmann
Der Beitrag musste leider unvorhergesehen abgesagt werden.
EMDR, Brainspotting und autobiographische Arbeit
N.N.Alte Kapelle, Hof 1
(Wie wir) Kinder mit komplexer Traumatisierung mit EMDR behandeln. Erste Evaluierung des Trauma Management Protokolls (EMDR TMP)
Melitta Schneider, Alphonce Omolo, Edgar Erdfelder
Mit BRAINSPOTTING „hinschauen“ – Unter Einbezug von Emotionen und Körper Integration von unverarbeiteten Inhalten unterstützen
Monika Baumann
EMDR-basierte Kurztherapie: Evaluation und Umsetzbarkeit von G-TEP (Group Traumatic Episode Protocol) als Akuttherapie in der ambulanten Versorgung – eine randomisierte Studie
Madeleine Hemmerde
Arbeit mit der Zeitlinie – schonende Integration belastender Lebenserfahrungen in die autobiografische Erzählung
Barbara Eckloff
16:00 - 16:45 Vorträge, Keynote Speaker
Grenzen der personalisierten Therapie unter Kriegsbedingungen
Helge HöllmerHS C1, Hof 2, Hörsaalzentrum
Auch wenn die Psychotherapieforschung die Effektivität von spezifischen Therapiemethoden nachgewiesen hat, ist deren Übertragung in die konkrete Sitzung bis heute nicht immer gesichert. Praktiker erleben immer wieder sehr unterschiedliche Ansprechraten, der doch so hocheffektiven Ansätze und individualisierten häufig die Therapien. Gleichzeitig strebt die Wissenschaft nach einer Steigerung der Effektivität, die in der personalisierten Therapie gesehen wird. Wenn aber das Individuelle nur noch als das eigentlich Gute bezeichnet wird, werden Kontexte der Gruppenforderungen Widerstandsgefühle auslösen.
Ich beabsichtige sie nun in eine Gruppenanforderungssituation zu entführen, in der dies kumuliert. In einen Kontext in der Gruppenanforderungen aufgrund fehlender Ressourcen von Zeit, Mittel oder Personen notwendig werden. Es soll hier um Situationen der militärischen Auseinandersetzung gehen, in der zwei fast gleichstarke Parteien aufeinandertreffen und dies über längere Zeit, so z.B. aktuell im Ukrainekrieg. Wenn täglich z.B. 100 Soldaten psychisch traumatisiert werden, stellt sich die Frage wann, wo und wie diese behandelt werden können? Wann können, dürfen oder müssen diese Personen wieder ins Kampfgeschehen zurück?
Diese Problembereiche sollen in diesem Vortrag dargestellt, angerissen und problematisiert werden. Sind dann überhaupt noch personalisierte Behandlungstechniken möglich und zielführend? Welche Antworten hat die Wissenschaft auf solche Situationen? Wie stellt sich ein Behandler um, wenn er dem Mainstream der personalisierten Psychotherapie anheimgefallen ist?
16:45 - 17:00 Tagungsabschluss, Verleihung Posterpreis der DeGPT
Tagungsabschluss, Verleihung Posterpreis der DeGPT
HS C1, Hof 2
Verleihung des Posterpreises der DeGPT und Abschlussworte mit einem Ausblick auf 2025
Keynotes
Wir freuen uns, folgende Keynotes in Wien begrüßen zu dürfen:
Prof. Dr. Malek Bajbouj (Berlin) Behandlung diverser Populationen
Dr. Helge Höllmer (Hamburg) Grenzen der personalisierten Therapie unter Kriegsbedingungen
Prof. Dr. Wolfgang Lutz (Trier) Evidenzbasierte Personalisierung in der Behandlung psychischer Störungen – wo stehen wir und wo wollen wir hin?
Dr. Pia Pechtel (Exeter) Trauma and the Brain: Bridging the Gap Between Neuroscience and Clinical Practice
Dr. Elisa Pfeiffer (Ulm) Traumatherapie im Kindes- und Jugendalter – aktuelle evidenzbasierte Verfahren und individuelle Bedürfnisse der Patient:innen
Prof. Dr. Martin Sack (München) Individuelle Therapieplanung – wie lässt sich das konkret umsetzen?
Assoc. Prof. Dr. Schultebraucks (New York) Skalierbare, automatisierte und praktikable Risikostratifizierung der posttraumatischen Belastungsreaktion und personalisierte Traumatherapie