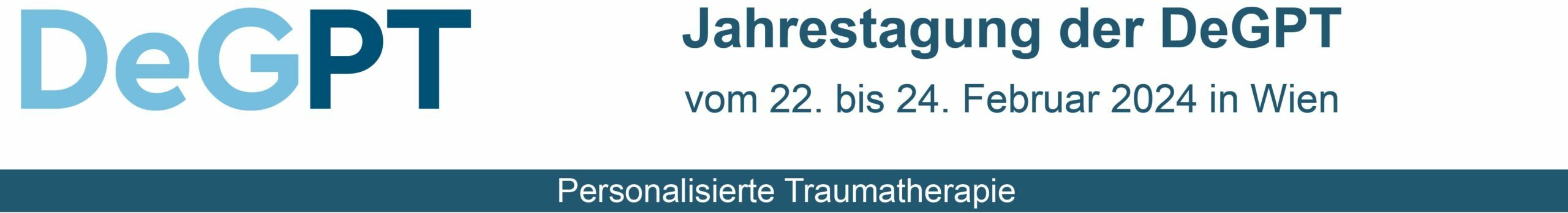Der Themenbereich „Verlust, Tod und Trauer“ bei Kindern und Jugendlichen ist nach wie vor ein großes Tabu. Trauer wird zumeist mit Tod und Sterben in Verbindung gebracht. Es wird wenig beachtet, dass es viele Veränderungen, Trennungen und Verluste gibt, wie etwa Übersiedlung, Schuleintritt, Krankenhausaufenthalte, Scheidung der Eltern, Jobverlust eines Elternteils und ähnliches mehr, die ebenso Trauerarbeit notwendig machen. Jorgos Canacakis definiert: „Trauer ist die gesunde, lebensnotwendige, kreative Reaktion auf Verlust- und Trennungsereignisse.“
Kinder werden gerne vertröstet, Tatsachen werden beschönigt und beschwichtigt. Jugendlichen spricht man oft Trauer ab, da sie sich im Verhalten anders als erwartet zeigen. Kinder trauern anders als Erwachsene oder Jugendliche. Drei Leitsätze sind wesentlich: „es ist, was es ist“ (Erich Fried), „die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar“ (Ingeborg Bachmann) und „das Totschweigen des Todes ist ein Problem der Erwachsenen und nicht der Kinder“ (Gertrude Bogyi).
Im Folgenden sollen Reaktionen von Kindern und Jugendlichen beschrieben werden, die nicht selten zu Missverständnissen führen. Immer wieder verdrängen Kinder zunächst ein Geschehen und tun so, als ob nichts wäre. Dies verführt die Erwachsenen leider dazu „mitzuspielen“ und dem Kind die Wahrheit zu verschweigen. Das Kind hat den verständlichen Wunsch, dass alles „normal“ weitergeht und verleugnet deshalb etwa die Tatsache des Todes, der Scheidung, der Krankheit. Manchmal zeigen sich Kinder auch übertrieben heiter, was bei Erwachsenen nicht selten zur Annahme führt, dass sie nicht trauern. Wut und Aggression gehören zu jedem Trauerprozess, werden aber oft nicht zugelassen und als unpassend empfunden und der Zusammenhang wird nicht erkannt. Schuldgefühle spielen ebenso eine große Rolle, wie die Angst, weiteres zu verlieren. Kinder weinen oft dann nicht, wenn es erwartet wird, sind aber bei kleinen Anlässen weinerlich und besonders empfindlich. Kinder trauern sprunghaft, punktuell.
Wichtig ist es, die Wahrheit zu sagen, sie am Geschehen, an den Ritualen, teilnehmen zu lassen, versuchen, sie in ihren Gefühlen zu verstehen, sich aber nicht aufdrängen. Vor allem ist es wichtig, eigene Gefühle anzusprechen. Jugendlichen fällt es meist schwer, ihre Gefühle zu verbalisieren. Sie kapseln sich oft ab, suchen verstärkt Ablenkung, das Autonomiebestreben verstärkt sich. Durch ihr Verhalten erfahren sie oft Ablehnung, finden kein Verständnis. Bei jedem Verlust sind Alter und Entwicklungsstufe, Persönlichkeitsstruktur des Kindes, Rolle der verlorenen Person im Gesamtleben, Art der Beziehung vor der Trennung oder dem Verlust und Reaktion bzw. Hilfestellung durch das Umfeld von Bedeutung. Obwohl Trauerwege sehr individuell sind, lassen sich doch einige gemeinsame Aspekte beschreiben.
Reaktionen und Interventionen sollen in diesem Workshop anhand von Fallbeispielen besprochen werden.