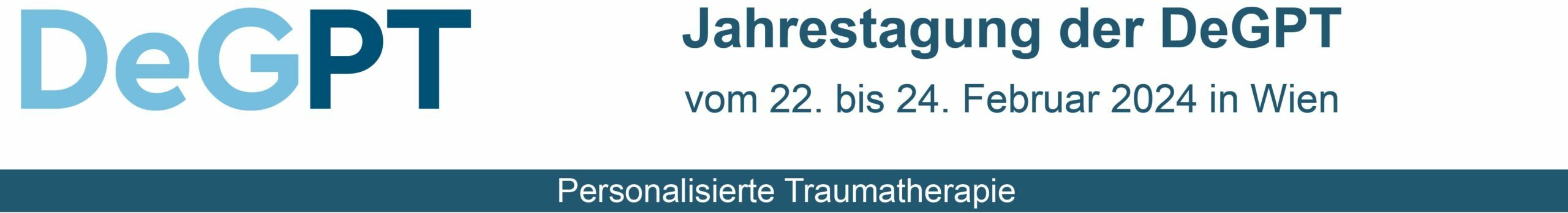Die traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie (Tf-KVT) ist ein evidenzbasiertes Verfahren zur Behandlung einfacher und komplexer posttraumatischer Belastungsstörungen im Kindes- und Jugendalter. Der Behandlungsansatz beruht auf den Arbeiten von Judith A. Cohen, Esther Deblinger und Anthony P. Mannarino, die in den USA psychotherapeutische Programme zur Überwindung von Folgen traumatischer Ereignisse wie sexuellem Missbrauch, Verlust eines geliebten Menschen, Erfahrungen von Gewalt, Terror u. a. Katastrophen entwickelten und publizierten. Die Tf-KVT integriert Elemente der klassischen KVT und adaptiert diese auf Traumafolgestörungen bei 4- bis 18-jährigen Kindern und Jugendlichen.
Im Rahmen des Workshops werden die verschiedenen Komponenten der Tf-KVT (Psychoedukation, Entspannungsverfahren, Emotionsregulation, Veränderung dysfunktionaler Kognitionen, Arbeit mit Traumanarrativen, Einübung von Copingstrategien, Arbeit mit den Eltern usw.) in theoretischer und praktischer Hinsicht vermittelt. Der Fokus im Workshop soll auf der Traumaexposition mit Hilfe des Traumanarratives liegen.
Archive
Wenn das Trauma mit am Küchentisch sitzt
Wenn Kinder oder Erwachsene traumatisiert wurden, hat dies nicht nur auf das Leben des Einzelnen massive Auswirkungen, sondern das Familiensystem als Ganzes steht oft vor grossen Herausforderungen und Belastungen. Auch nicht traumatisierte Familienmitglieder leiden oft unter den Symptomen und Folgen. Teilweise begegnen wir Familien, in denen Kinder und Eltern traumatisiert sind. Im Praxisalltag erleben wir leider zu oft, dass in den Einzeltherapien die systemische Ebene zu wenig gesehen wird. Durch die Trennung von Kinder-/Jugendtherapie und Erwachsenentherapie ergeben sich Hindernisse in der Zusammenarbeit. Uns stehen heute gut fundierte und wirksame Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die jedoch zu selten eine Verknüpfung vom Einzelnen zur Familie herstellen.
Wir wollen im Workshop diese Lücke schliessen und den Teilnehmenden die Möglichkeit geben, den Blick auf das ganze Familiensystem und dessen Behandlungsmöglichkeiten zu richten. Dabei werden wirksame Therapieoptionen, Interventionsmöglichkeiten und wichtige Zusammenhänge, die im Therapiealltag gut umsetzbar sind, vorgestellt.
Individuelle Behandlungsplanung bei Patient:innen mit komplexen Traumafolgestörungen
Erfahrungen von schwerer Gewalt und Vernachlässigung vor allem in der Kindheit und Jugend können im späteren Leben zu einer Vielzahl von psychischen und psychosomatischen Symptomen führen. Typische Folgen sind Probleme mit der Regulation von Affekten, der Selbstakzeptanz, Scham, Schuldgefühle und Probleme in zwischenmenschlichen Beziehungen. Der Zusammenhang zwischen kindlichen Traumatisierungen und körperlichen wie psychischen Erkrankungen ist auch durch aktuelle Befunde der Neurobiologie eindrücklich belegt. Die Diagnose komplexe PTBS findet zunehmend Anerkennung und wird voraussichtlich in die ICD-11 eingeführt werden.
Zentrale Elemente der Behandlung sind therapeutischer Beziehungsaufbau, Förderung der Affektregulation, Verbesserung von Selbstbezug und Selbstwert sowie Förderung der Beziehungsfähigkeit. Auf die Indikation zum Einsatz traumakonfrontativer Methoden bei Patienten mit komplexen Traumafolgestörungen und wird im Rahmen einer methodenintegrativen und auf individuelle Behandlungsbedürfnisse ausgerichteten Behandlungsplanung besonders eingegangen. Es ist erwünscht, dass Teilnehmer eigene Fallbeispiele und Fragen aus der Praxis einbringen.
Existentielle Psychotraumatherapie – Kernfragen des Daseins in der therapeutischen Praxis. Ein neuer Ansatz zur Behandlung belastender Selbst- und Weltkonzepte.
Solange Menschen keine größeren Lebensbelastungen haben, können sie Themen wie Tod, Einsamkeit, Verantwortung oder Sinnlosigkeit häufig ignorieren. Schicksalsschläge oder Traumatisierungen lösen für viele, Erfahrungen aus Krieg und Pandemie wohl für die meisten, diese sicher geglaubte Distanz auf. Das innere Gleichgewicht wird anhaltend erschüttert. Klinisch finden sich inzwischen häufig Überlappungen zwischen individuellen traumareaktiven Mustern und Beschwerden, die sich aus der Konfrontation mit den gegenwärtigen Weltkrisen ergeben.
Die existentielle Psychotherapie sieht einen Grundkonflikt als zentral im Erleben und Handeln von Menschen, den der Konfrontation mit den Gegebenheiten der Existenz. Irving D. Yalom und andere haben schon vor mehr als 40 Jahren hilfreiche Konzepte entwickelt, um Menschen durch existentielle Herausforderungen zu begleiten. Diese erwiesen sich für Menschen in traumatischem Stress als nur wenig geeignet. Für den Traumakontext hat der Referent daher die existentielle Psychotherapie für traumatische Erschütterungen neu formuliert.
Aus klinischer Perspektive werden die zentralen Grunddimensionen vorgestellt:
• Verlust von Integrität, Verletzlichkeit, Endlichkeit und Tod
• Wille und Freiheit, Verantwortung
• Isolation und Einsamkeit, Bindungserschütterung
• Auseinandersetzung mit dem „real Bösen“
• Lebenssinn, Entfaltung der Potenziale und Verzicht
Ziel der Interventionen ist die Umarbeitung negativer Selbst- und Weltkonzepte
Anhand zweier Langzeittherapien komplexer Traumafolgestörung werden die Schritte
• Markieren der Grunddimension und Expressionsfähigkeit
• Symptomebene, konstruktive Nutzung der Abwehr
• Spez. Beziehungsarbeit
• Interventionstechniken, Nutzung von Alltagsphänomenen
gezeigt und der klinische Verlauf vorgestellt.
(Veröffentlichung hierzu: Rießbeck, H., Existentielle Perspektiven in der Psychotraumatologie, Nov. 2021, Klett-Cotta Verlag)
Behandlung der Komplexen PTBS: Das Therapieprogramm „STAIR/NT“
Personen, die in ihrer Kindheit sexuellen Missbrauch oder Misshandlung erlebt haben, leiden oft nicht nur unter Symptomen der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), sondern auch unter weiteren Beeinträchtigungen, etwa einer eingeschränkten Affektregulation, Schwierigkeiten in interpersonellen Beziehungen und einem negativen Selbstbild. Gerade diese zusätzlichen Symptombereiche, die inzwischen als typische Beschwerden im Rahmen einer „Komplexen PTBS“ interpretiert werden, tragen maßgeblich zu den Alltagseinschränkungen Betroffener bei. Bei „STAIR/Narrative Therapie“ handelt es sich um einen Behandlungsansatz, der genau diese Bereiche systematisch berücksichtigt und zusätzlich zur Reduktion der PTBS-Symptomatik eine flexible Behandlung von Defiziten der Emotionsregulation und der interpersonellen Kompetenzen bei traumatisierten Personen erlaubt. Das Therapieprogramm integriert in einem phasenorientierten Vorgehen wirksame Interventionen zur Behandlung komplexer Traumafolgestörungen und wird in den neuen Behandlungsleitlinien als eines der Standardverfahren empfohlen. Im Workshop wird ein Überblick über das Therapieprogramm gegeben sowie auf seinen Einsatz im Einzel- wie im Gruppensetting eingegangen. Neben der theoretischen Einführung wird es eine Reihe von praktischen Übungen geben.
Literatur
Cloitre M, Cohen LR, Koenen KC (2013) Sexueller Missbrauch und Misshandlung in der Kindheit. Ein Therapieprogramm zur Behandlung komplexer Traumafolgen. Göttingen: Hogrefe-Verlag.