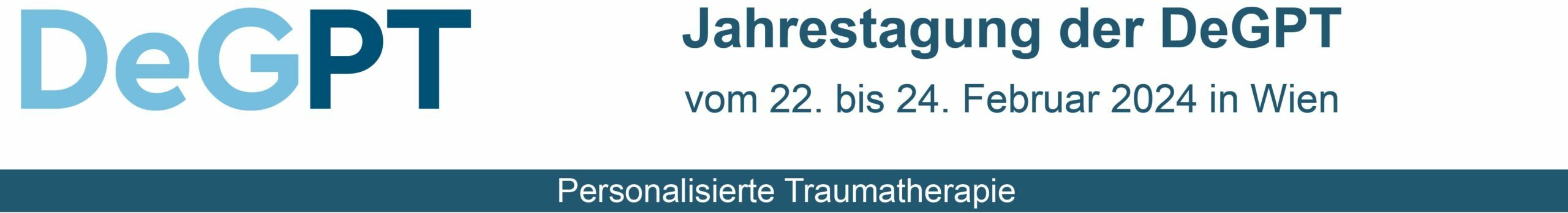Emotionale Misshandlung: Verschiedene Erscheinungsformen und Expositionsfaktoren
Meret Wallimann, Julia Quehenberger, David Lätsch
Die Rolle der Selbstwirksamkeit in der Assoziation zwischen früheren Misshandlungs- und Vernachlässigungserfahrungen und späterer Lebensqualität bei ehemals fremdplatzierten jungen Erwachsenen
Milou Leiting, David Bürgin, Katharina Beck, Jörg M. Fegert, Nils Jenkel, Cyril Boonmann, Klaus Schmeck, Marc Schmid
Selbstwirksamkeit, beeinträchtigte Persönlichkeitsfunktionen und soziale Unterstützung sagen Residualresilienz in ehemals fremdplatzierten jungen Erwachsenen vorher
Clara von Wendorff, Maria Meier, David Bürgin, Marc Schmid, Vera Clemens
Exploring age-related subgroups of different types of maltreatment across childhood – Findings in young adults with previous youth residential care placements
Anais Gasser, David Bürgin, Jörg M. Fegert, Nils Jenkel, Cyril Boonmann, Klaus Schmeck, Marc Schmid
Erfahrungen und Wahrnehmungen von ambulanten Patienten im Rahmen der pferdegestützten Psychotherapie – eine phänomenologische Studie
Sibylle Müller, Jochen Binder, Flavio Heller, Manuel Stadtmann
Der Hund als Medium für eine gelingende Beziehungsaufnahme in der Traumatherapie: Eine qualitative inhaltsanalytische Untersuchung
Ronja Dieterle, Jochen Binder, Flavio Heller, Manuel Stadtmann
Die Entwicklung eines gruppentherapeutischen Angebotes für die Tagesklinik für Traumafolgestörungen: Eine Co Creation Methodologie
Manuel Stadtmann, Flavio Heller, Christoph Jans, Jochen Binder
Die Rolle negativer posttraumatischer Kognitionen bei der Behandlung von Patient:innen mit posttraumatischer Belastungsstörung
Silvia Gradl, Juliane Burghardt, Claudia Oppenauer, Manuel Sprung
Zur Bedeutung von Erinnerungsfragmentierung in der psychotherapeutischen Arbeit mit PTBS-Patient:innen: Vorläufige Ergebnisse der MemFraT-Studie
Lina Krakau, Rayan El-Haj-Mohamad, Laura Nohr, Matthias F.J. Sperl
Einführung in die Ressourcenfokussierte Traumaanamnese (RFTA) in der Behandlung komplextraumatisierter Patient:innen
Steffen Bambach
Die Inhibitionstheorie: Entwicklung von Glück und Zufriedenheit nach einschneidenden Lebensereignissen (Querschnittslähmung) – eine qualitative Exploration des Zufriedenheitsparadoxons
Tanja Ecken, Laura Fricke
Entwicklung und Validierung des International Trauma Questionnaire – Caregiver (ITQ-CG): Erfassung der (K)PTBS nach ICD-11 bei Kindern und Jugendlichen aus Fremdperspektive
Alexander Haselgruber, Dina Weindl, Brigitte Lueger-Schuster
Auswirkung mütterlicher Misshandlung in der Kindheit auf die Mutter-Kind-Bindung nach der Geburt und Glukokortikoide im Haar
Luisa Bergunde, Marlene Karl, Miriam Borrmeister, Isabel Jaramillo, Victoria Weise, Judith T. Mack, Kerstin Weidner, Wei Gao, Susann Steudte-Schmiedgen, Susan Garthus-Niegel
Geburtsbezogene PTBS-Symptome und Eltern-Kind-Bindung bei Müttern und Vätern und die mediierende Rolle des Stillens: Ergebnisse einer prospektiven Kohortenstudie
Victoria Weise, Tilman von Soest, Lara Seefeld, Pauline Wimberger, Julia Martini, Eva Asselmann, Susan Garthus-Niegel
Behandlungs- und Beratungspräferenzen sowie -barrieren von postpartalen Frauen mit Symptomen einer (geburtsbezogenen) PTBS und Erfahrungen von Partnerschaftsgewalt
Lara Seefeld, Valentina Jehn, Laura Hausmann, Amera Mojahed, Susan Garthus-Niegel, Julia Schelllong
Psychodiagnostik in der psychosozialen Versorgung geflüchteter Menschen: Was sind die aktuellen Herausforderungen und wie können sie überwunden werden?
Amelie Pettrich, Yuriy Nesterko, Elisa Rimek, Heide Glaesmer
Verfügbarkeit und Durchführbarkeit von Behandlungen mit Geflüchteten im klinischen Routinesetting: Daten zum Patient:innen-Flow sowie zu Therapiedropout bei Refugio München
Theresa Koch
Entwicklung und Validierung eines Fragebogens zur Erfassung von Rollenkonflikten bei Dolmetschenden in der Arbeit mit geflüchteten Menschen – Der Rollenkonflikt-Fragebogen (RoKo)
Angelika Geiling, Laura Nohr, Caroline Meyer, Maria Böttche, Christine Knaevelsrud, Nadine Stammel
„Kräfte stärken – Trauma bewältigen“: Skill-training in Erstsprachen als niedrigschwellige Möglichkeit zur Traumabewältigung und Emotionsregulation bei geflüchteten Schüler:innen in Wien
Sabine Kampmüller
Long-term physical and mental health correlates of early-life compulsory social measures and/or placements in Swiss survivors of advanced age
Myriam V. Thoma, Florence Bernays, Andreas Maercker, Shauna L. Rohner
Suicidality of people with experiences in youth welfare institutions of the GDR – During and after residential care
Doreen Hoffmann, Maya Böhm, Heide Glaesmer
Aspects of social support and disclosure in the context of institutional abuse – Long-term impact on mental health
Brigitte Lueger-Schuster, Asisa Butollo, Yvonne Moy, Reinhold Jagsch, Tobias Glück, Viktoria Kantor, Matthias Knefel, Dina Weindl
Childhood maltreatment and later life prosocial behaviour: A qualitative investigation with institutional and familial abuse survivors
Shauna L. Rohner, Aileen N. Salas Castillo, Alan Carr, Myriam V. Thoma
Polyviktimisierung bei Kindern in Fremdunterbringung: Wie hängen vergangene (Beziehungs-) Erfahrungen mit der gegenwärtigen Eltern-Kind-Beziehung zusammen?
Nina Heinrichs, Antonia Brühl
Viktimisierungserfahrungen bei Kindern und Jugendlichen in Fremdunterbringung alltagsnah erfassen: Was können wir von Smartphone-basierten Erhebungen lernen?
Kerstin Konrad, Maren Boecker, Marco Giurgiu, Ulrich Ebner-Priemer, Sophie Niestroj
Eine internetbasierte Intervention gegen Reviktimisierung für Jugendliche und junge Erwachsene in Fremdunterbringung: Erste Ergebnisse einer randomisierten Kontrollgruppenstudie
Betteke van Noort, Lucia Emmerich, Birgit Wagner
Biografiearbeit für fremduntergebrachte Jugendliche – Ergebnisse der Pilotstudie zur Gruppenintervention ANKOMMEN
Miriam Rassenhofer, Jörg M. Fegert, Steffen Schepp, Andreas Witt, Elisa Pfeiffer
Sexualisierte Gewalterfahrungen in der Kindheit bei weiblichen Inhaftierten und deren Bedeutung für Kriminalitätsfaktoren und die Gestaltung von Resozialisierungsmaßnahmen
Susanne Deitert, Heide Glaesmer
Sexualisierte Gewalt und psychische Belastungen bei Geflüchteten mit LGBIQ+-Hintergrund
Heide Glaesmer, Kim Hella Schönenberg, Yuriy Nesterko
Offenlegungsprozesse kriegs- und vertreibungsbezogener sexualisierter Gewalt bei männlichen Überlebenden
Kim Hella Schönenberg, Heide Glaesmer, Yuriy Nesterko
Hürden und Fazilitatoren für die Inanspruchnahme professioneller Versorgungsangebote nach erfahrener sexueller Gewalt aus Betroffenenperspektive
Marie Kaiser, Heide Glaesmer
Individualisierte Traumatherapie für Kinder und Jugendliche: Eine systematische Übersichtsarbeit
Sarah K. Schäfer, Max Supke, Lea Thomas, Aylin Schumann, Klaus Lieb
Wirksamkeit und Moderatoren der Wirksamkeit von traumafokussierten kognitiven Verhaltenstherapien bei Kindern und Jugendlichen: Eine individual participant data meta-analysis
Anke de Haan
Mobbing und posttraumatische Stresssymptome bei Kindern und Jugendlichen: Ist es Zeit, das A-Kriterium aus einer Entwicklungsperspektive zu überdenken?
Cedric Sachser, Jacob Segler, Lucy Berliner, Rita Rosner, Elisa Pfeiffer, Marianne Birkeland, Tine Jensen
KI-gestützte Erfassung flexibler Emotionsregulation: Anwendbarkeit und Zusammenhang mit klinischen Zielparametern bei Jugendlichen
Ann-Christin Haag, Rohini Bagrodia, Tanya Sharma, George A. Bonanno
Rituelle Gewalt – Herausforderung für Therapie und Beratung
Axel Seegers
Die dissoziative Identitätsstörung – historische Entwicklung und Definition
Stefan Röpke
Die dissoziative Identitätsstörung – empirische Befunde
Kathlen Priebe
Scheinerinnerungen und Suggestion in der Psychotherapie
Renate Volbert