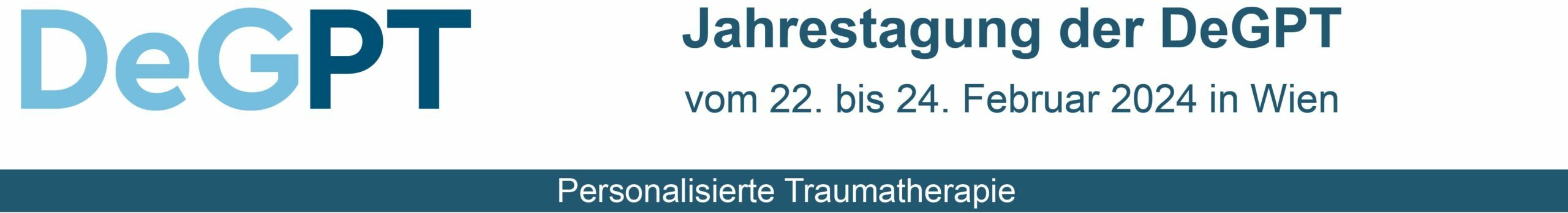(Wie wir) Kinder mit komplexer Traumatisierung mit EMDR behandeln. Erste Evaluierung des Trauma Management Protokolls (EMDR TMP)
Melitta Schneider, Alphonce Omolo, Edgar Erdfelder
Mit BRAINSPOTTING „hinschauen“ – Unter Einbezug von Emotionen und Körper Integration von unverarbeiteten Inhalten unterstützen
Monika Baumann
EMDR-basierte Kurztherapie: Evaluation und Umsetzbarkeit von G-TEP (Group Traumatic Episode Protocol) als Akuttherapie in der ambulanten Versorgung – eine randomisierte Studie
Madeleine Hemmerde
Arbeit mit der Zeitlinie – schonende Integration belastender Lebenserfahrungen in die autobiografische Erzählung
Barbara Eckloff
Kann eine neue Lebenssinn-fokussierte Intervention psychische Belastungssymptome nach einem aversiven Film reduzieren?
Lea-Jasmin Seidel-Koulaxis
Der Einfluss des Oxytocinsystems auf die Acquisition und Konsolidierung von intrusiven Erinnerungen nach einem Traumafilm
Tolou Maslahati, Katharina Schultebraucks, Katja Wingenfeld, Christian Otte, Milagros Galve, Julian Hellmann-Regen, Stephan Ripe, Stefan Roepke
Schlaf verstärkt die Abnahme der PTBS-Symptome bei stationären Patient:innen nach einer traumafokussierten Intervention
Laura Meister, Alex Rosi-Andersen, Yasmine Azza, Natalie Muellner, Michael Colla, Erich Seifritz, Steven Brown, Birgit Kleim
Predicting Intrusive Memories Through Trauma Narratives in PTSD
Valerie Hofmann
Der Beitrag musste leider unvorhergesehen abgesagt werden.
Kriegsbezogene Stressoren und (komplexe) posttraumatische Belastungsstörungen während des russischen Krieges in der Ukraine
Annett Lotzin, Lisa Schratz, Antje Paetow, Olga Morozova-Larina, Vladyslava Keller, Liudmyla Krupelnytska
Zugang zu psychischer Gesundheitsversorgung bei syrischen Geflüchteten in Leipzig
Kim Schönenberg, Yuriy Nesterko, Heide Glaesmer
Die Evaluierung des Versorgungsmodells „Koordinierte Behandlung unter Einbezug von Gesundheitspatient:innen“ (KOBEG) für psychisch belastete Geflüchtete: Zwischenergebnisse des laufenden RCTs
Michael Odenwald, Leonie Lipinski, Marius Grimm, Brigitte Rockstroh, Daniela Mier, Lea Bogatzki
Entwicklung und Erprobung eines Trainings-Curriculums zur Peer-gestützten psychosozialen Unterstützung traumatisierter Geflüchteter
Ingo Schäfer, Anna Berckhemer, Lena Nugent, Rebecca Nixdorf, Yuriy Nesterko, Heide Glaesmer, Fabienne Führmann, Iris Graef-Calliess, Candelaria Mahlke, Annett Lotzin
Dissemination und Implementierung von TF-KVT mit Kindern und Jugendlichen in sieben europäischen Ländern
Johanna Unterhitzenberger, Pia Enderby, Tine Jensen, Aino Juusola, Zlatina Kostova, Ramon Lindauer, Sanna-Kaija Nuotio, Poa Samuelberg, Elisa Pfeiffer
CBITS – Evaluation der „Kognitiven Behavioralen Intervention für Trauma in Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen in Deutschland“ – eine randomisierte kontrollierte Studie
Jessica Köksal, Loni Dörrie, Cedric Sachser, Elisa Pfeiffer
Interdisziplinäre Kooperation zur Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Traumafolgestörungen
Katharina Szota, Rieka Kamps, Hanna Christiansen
Viktimisierungserfahrung und posttraumatische Belastungssymptome bei Kindern und Jugendlichen in Fremdunterbringung: Die mediierende Rolle von Mentalisierung
Lucia Emmerich, Betteke van Noort, Birgit Wagner
Interdisziplinäre Versorgung von Kindern, Jugendlichen und Familien mit Fluchterfahrung in Erstunterkünften
Andrea Hahnefeld, Matthias Klosinski
Akkulturation von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten und mögliche Einflussfaktoren
Maike Garbade, Jenny Eglinsky, Heinz Kindler, Rita Rosner, Cedric Sachser, Elisa Pfeiffer
With a little help from my friends? Akkulturation and psychische Gesundheit bei arabischsprachigen Jugendlichen mit Fluchterfahrung
Caroline Meyer, Lina Alhaddad, Nadine Stammel, Frederick Sixtus, Jenny Sarah Wesche, Rudolf Kerschreiter, Patricia Kanngießer, Christine Knaevelsrud
Akkulturationsstrategien, wahrgenommene Diskriminierung und Lebenszufriedenheit bei Leipzigerinnen syrischer Nationalität
Yuriy Nesterko, Kim Schöneberg, Heide Glaesmer
“Can you hear me?” Muffled Voices Despite Open Ears
Mariam Fishere
Der Beitrag musste leider unvorhergesehen abgesagt werden
Gilt das Menschenrecht auf Gesundheitsversorgung universell? Ein Beitrag aus traumatherapeutischer Sicht
Markus Stingl, Bernd Hanewald
Aus der Praxis: Das Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch – Beratung als Puzzleteil einer interdisziplinären personalisierten Unterstützung für Betroffene und Dritte
Merle Frey
„Ich suche etwas, was mir wirklich hilft!“ – Einflüsse von Geschlecht und Lebensumfeld von Betroffenen auf den Erhalt professioneller Hilfe
Frederike-Kristina Mattstedt, Jelena Gerke, Miriam Rassenhofer
Auf der Suche nach professioneller Hilfe – Einfluss des Täter:innengeschlechts
Jelena Gerke, Frederike-Kristina Mattstedt, Miriam Rassenhofer
Mein Weg durchs OEG | Kooperationsprojekt. Eine betroffeneninitiierte Online-Umfrage zum Antrags- und Prüfverfahren im Rahmen des Opferentschädigungsgesetz (OEG) für Gewaltopfer
Isabella Flatten-Whitehead, Frau Rapunzel, Gudrun Stifter, Ingo Fock, Miriam Rassenhofer, Jörg M. Fegert
Stressbezogene Kognitionen im Vorschulalter und ihr Zusammenhang mit psychischen Auffälligkeiten
Mira Vasileva
DSM-5 PTBS-Symptome und funktionelle Beeinträchtigung bei trauma-exponierten Vorschulkindern: Ein Netzwerkansatz
Lasse Bartels, Markus A. Landolt, Lucy Berliner, Cedric Sachser
Prä-Post-Studie zur Bewertung einer EMDR-basierten Gruppentherapie für traumatisierte Flüchtlingskinder im Vorschulalter in Kindertagesstätten
Franka Metzner-Guczka, Daniela Lempertz, Kerstin Stellermann-Strehlow, Michelle Wichmann, Silke Pawils
Der Ausgangspunkt: Betroffene erzählen – Erfahrungen der Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs mit organisierter sexualisierter und ritueller Gewalt
Silke Gahleitner
Herausforderungen in der Diagnostik der Dissoziative Identitätsstörung: Falsch-negative und falsch-positive Diagnosen
Ursula Gast
Artifizielle Erinnerungen, Falschbeschuldigungen und falsches Zweifeln
Jan Gysi
Unterschiedliche Definitionen, psychotherapeutische Über- und Unterbetonungen und Wissensdefizite zu organisierten Gewaltformen
Susanne Nick
Weiterentwicklungen in der DBT für Erwachsene – Traumafokussierte Therapie der Borderline Persönlichkeitsstörung
Miriam Biermann, Christian Schmahl, Martin Bohus, Ruben Vonderlin, Nikolaus Kleindienst
DBT-PTBS in der Adoleszenz
Christian Schmahl, Sven Cornelisse, Miriam Biermann, Frank Enning, Nikolaus Kleindienst
Transfer der DBT-PTBS in den klinischen Alltag
Claudia Oppenauer, Manuel Sprung, Silvia Gradl, Juliane Burghardt
Ein systematischer und meta-analytischer Überblick zur Dialektischen Verhaltenstherapie bei posttraumatischer Belastungsstörung
Oswald D. Kothgassner, Karin Prillinger, Claudia Oppenauer, Andreas Goreis, Carola Hajek Gross, Annika Lozar, Selina Fanninger, Anna Mayer, Sarah Macura, Paul Plener
Psychische Belastungs- und Resilienzfaktoren von Geflüchteten aus der Ukraine – Eine Studie unter behandlungsaufsuchenden Menschen im Mental Health Center Ukraine
Jewgenija Korman, Anastasiia Burdym, Theresa Koch
Mein Weg – traumafokussiertes Gruppenmentoring für Studienanfänger:innen aus der Ukraine
Brigitte Lueger-Schuster, Theresa Wagner, Thorsten Sukale, Elisa Pfeiffer
„TF-CBT Ukraine“- Evaluation der Implementierung einer evidenzbasierten Traumatherapie für Kinder und Jugendliche in der Ukraine während des Krieges
Elisa Pfeiffer, Maike Garbade, Cedric Sachser, Vitalii Klymchuk
PRACTICE Makes Progress – Evidenzbasiertes Selbstfürsorge-Programm für Ukrainische Therapeut:innen während des Krieges
Fabienne Krech, Maike Garbade, Elisa Pfeiffer, Beth Cooper, Elisabeth Pollio, Esther Deblinger